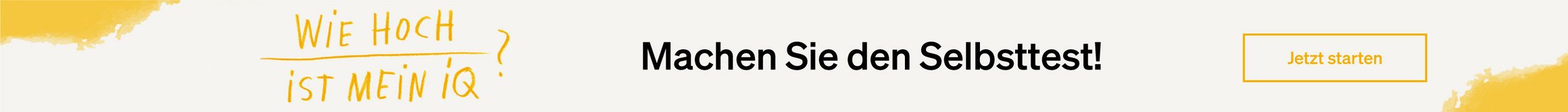Sozialpsychologie
Die Sozialpsychologie erforscht, wie sich Menschen gegenseitig beeinflussen. Mit Experimenten und anderen wissenschaftlichen Methoden werden nicht nur Dynamiken in Paarbeziehungen oder Interaktionen in Gruppen untersucht, sondern auch der indirekte soziale Einfluss – zum Beispiel durch Werbebotschaften .
Eine Grundannahme der Sozialpsychologie ist, dass Menschen soziale Lebewesen sind: ohne familiäre, freundschaftliche oder Paarbeziehungen vereinsamen wir. Die Einbindung in eine Gruppe – eine Partei, einen Fußballverein oder eine Gewerkschaft – bringt vielfältige, auch gesundheitliche Vorteile mit sich; man fühlt sich zugehörig, teilt Wertvorstellungen und andere Merkmale. Forschende untersuchen soziale Phänomene wie Empathie, Kooperation und Hilfsbereitschaft – aber auch die dunklen Seiten des Miteinanders: Unter welchen Bedingungen sind Gruppendruck oder eine charismatische Führungsperson stärker als unser moralischer Kompass? Verleitet Gruppendenken zu schlechteren Entscheidungen? Wie lässt sich Gewaltbereitschaft vorbeugen?
Sozialpsychologische Studien und Modelle können helfen, den gesellschaftlichen Umgang mit Krisen und Krieg einzuordnen. So wird die Schieflage zwischen unserem Wissen um die Klimakrise und unserem Umweltverhalten gerne mit der Konsistenztheorie erklärt: Sie besagt, dass wir lieber Fakten zurechtrücken, als einmal etablierte Gewohnheiten zu ändern. Besonders im Kontext der Coronakrise beschäftigen sich Sozialpsychologinnen und Sozialpsychologen zudem mit der massiven Verbreitung von Verschwörungserzählungen und der Frage, wie wir uns gegen Fake News wappnen können.