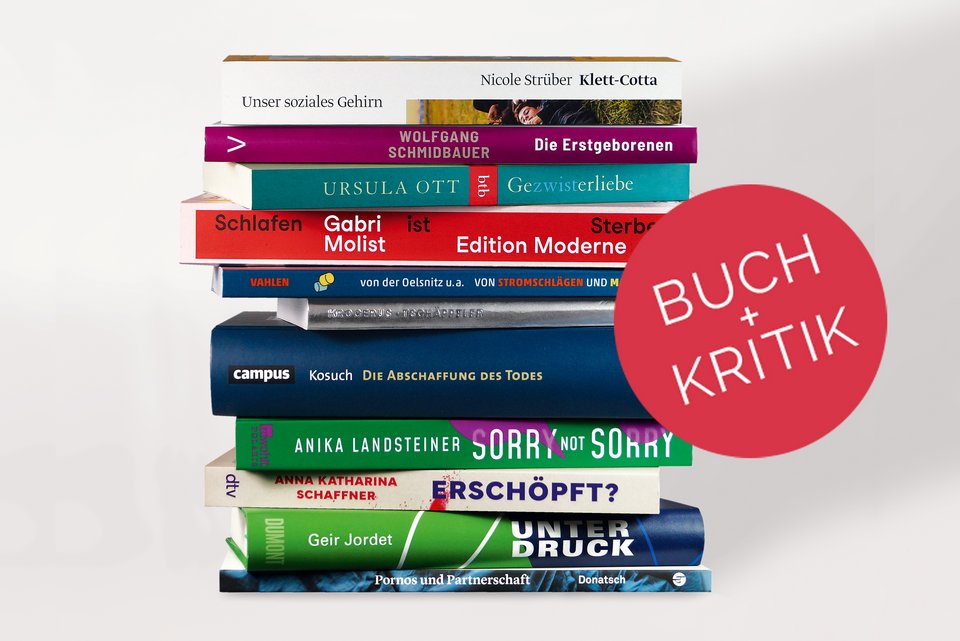In einer Zeit, die geprägt ist von Polarisierung, Hass und Hetze im Netz, Krieg und Gewalt, in einer Welt, die zwar vernetzt, aber nicht verbunden ist, hat Nicole Strüber ein Buch verfasst, das das Miteinander in den Mittelpunkt stellt. Schon der Titel zeigt, dass die Neurobiologin sich auch für ein Miteinander der Disziplinen starkmacht: Unser soziales Gehirn vereint nämlich Erkenntnisse aus der Neurobiologie, der Soziologie und der Psychologie. Und es ist nicht Strübers erste Publikation. Die Wissenschaftsautorin hat sich mit Wie das Gehirn die Seele macht, Risiko Kindheit, Coronakids und Die erste Bindung als Kennerin des Themengebiets erwiesen.
Die Autorin versteht es, Komplexes zu strukturieren und durch persönliche Anekdoten, Beispiele und verständliche Sprache für alle zugänglich zu gestalten. Studienergebnisse schiebt sie stets lesefreundlich in kleine abgesetzte Passagen. Damit sich das Lesepublikum behutsam dem riesigen Thema näher kann, ist das neurowissenschaftliche Sachbuch in zwei Teile gegliedert: Zunächst erklärt Strüber, warum das Gehirn unser Miteinander braucht. Sie zeigt, wie in der frühen Kindheit unser Oxytocinsystem entsteht und wie das Bindungshormon Synchronisation und gegenseitiges Verständnis und Empathie ermöglicht. Im zwischenmenschlichen Kontakt sind allerdings nicht nur nonverbales Verhalten, Gefühle und Stresslevel im Gleichklang, sondern auch die Aktivitäten der Gehirne. Sind sie in der Interaktion synchron, verstärkt das die Ausschüttung von Oxytocin und begünstigt dadurch eine weitere Synchronisation. „Engelskreis“, nennt Strüber das.
„Gemeinsam schaffen wir das“
In welchen Bereichen unseres Lebens wir diese Engelskreise brauchen, vermittelt sie im zweiten Teil des Buchs: In kürzeren Essays untersucht sie die Bedeutung des Miteinanders bei Geburt, in Familien, Partnerschaft, im Freundeskreis, im Kindergarten, in der Schule, bei der Arbeit, zwischen den Kulturen, in der Pflege und in der Beziehung zwischen Ärztin und Patient. Im Zuge dessen geht sie auch auf die Psychotherapie ein. Diese kann, so schreibt Strüber, die Fähigkeit verbessern, eigene Gefühle zu steuern und sich mit anderen zu synchronisieren.
Sie zieht den Vergleich zu früher: So wie wir als Kinder (bestenfalls) durch das synchrone Miteinander mit den Eltern lernten, unsere Gefühle zu regulieren, können Therapeutinnen und Psychologen das für ihre Patienten auch tun – vor allem durch nonverbales Verhalten. „Ein hohes Ausmaß an nonverbaler Synchronität charakterisiert eine positive Allianz“, schreibt Strüber. Die therapeutische Allianz – im Sinne von „Gemeinsam schaffen wir das“ – ist notwendig für eine erfolgreiche Therapie. Denn Stresshormone verstärken laut Strüber starres Verhalten, während Oxytocin Veränderung fördert. Und diese Veränderung brauchen wir, um Stress zu mindern, Emotionen zu regulieren und wieder im gleichen Takt miteinander zu agieren. Oder wie die Autorin es formuliert: Miteinander fördert Miteinander.
Nicole Strüber: Unser soziales Gehirn. Warum wir mehr Miteinander brauchen. Klett-Cotta 2024, 384 S., € 20,–
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? Wir freuen uns über Ihr Feedback!
Haben Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Beitrag oder möchten Sie uns eine allgemeine Rückmeldung zu unserem Magazin geben? Dann schreiben Sie uns gerne eine Mail (an: redaktion@psychologie-heute.de).
Wir lesen jede Nachricht, bitten aber um Verständnis, dass wir nicht alle Zuschriften beantworten können.