In meinem ersten Psychiatrie-Praktikum lernte ich Didi kennen. Didi war ein Sozialarbeiter der alten Schule. Wenn ich morgens in die Klinik kam, war er noch nicht da. Wenn ich nachmittags ging, sah ich ihn rauchend auf dem Balkon vor seinem Büro stehen. Manchmal winkte er mir zum Abschied zu. Didi war selbst beim Winken lässig. Als wolle er eine Fliege wegwedeln. Als Sozialarbeiter in der Psychiatrie war er zuständig für Fragen zur beruflichen Wiedereingliederung und Perspektivfindung, zu ambulanten Betreuungsangeboten, rechtlichen Fragen, dem Umgang mit Schulden und vielen anderen sozialen Themen. In meiner Ausbildung lerne ich, den individuellen Umgang mit Herausforderungen zu begleiten. Wenn Menschen in Systemen leben, die ihnen schaden, sie aber wenige Ressourcen haben, um sich daraus zu befreien, dann kann sich das für beide Seiten anfühlen, wie ein Kampf gegen Windmühlen. Deshalb ist das Zusammenspiel von Sozialer Arbeit, Pflege, Medizin und Psychotherapie so zentral für eine erfolgreiche Behandlung. Unbedingt möchte ich Didis Arbeit besser kennenlernen.
Einmal besuche ich sein soziales Kompetenztraining. Die Gruppe ist unter den Patientinnen sehr beliebt. Sie alle wollen wissen, was der rauchende, bärenförmige Didi über ihre Probleme denkt. Herr T., ein junger und etwas einsamer Mann, erzählt davon, dass er sich schäme, seinen Abschluss noch nicht zu haben. Er sei doch als Mann verpflichtet, Geld zu verdienen. Vorher müsse er sich sicher nicht um eine Frau bemühen. Die Frauen im Raum schnauben empört durch die Nase. Als würden sie nicht ihr eigenes Geld verdienen. Als ginge es ihnen darum. Der zweite Mann im Raum, Herr F., blickt betont unbeteiligt in die Leere. Besser nicht in die Schusslinie geraten, denkt er sich wohl. Didi aber lacht. „Mann, Herr T., Sie sind ja ein richtiger Spießer! So sehen Sie gar nicht aus, mit Ihren hippen Klamotten! Hätte nicht gedacht, dass Sie jemand mit Großvater-Werten sind.“
Ich halte den Atem an. Im Studium lernte ich nur die fürsorgliche Strategie kennen: aktiv zuhören, nicht-wertend paraphrasieren, validieren. Didi macht ziemlich wenig davon. Mit seiner Gesprächstaktik wäre ich bei meiner Dozentin durchgefallen. „Bin ich ja eigentlich auch nicht“, druckst Herr T. rum, „bei anderen denk‘ ich das ja gar nicht!“ „Aber sich selbst machen Sie es sich lieber richtig schwer, oder? Ist ja sonst langweilig!“ Die Gruppe, inklusive Herrn T., lacht. Danach schlägt Didi sanftere Töne an. Es entsteht ein Gespräch darüber, dass Herr T. versuche, sich vor Zurückweisung zu schützen, indem er von vornherein ausschließt, überhaupt jemanden anzusprechen. Seine normativen Vorstellungen dienen ihm als Rechtfertigung.
„Hast du Zeit, die Gruppe nachzubesprechen?“, bitte ich Didi. „Wenn‘s sein muss“, murrt er und grinst. Er drückt mir eine Tasse Kaffee in die Hand. Natürlich ist der Kaffee bitterstark und er hat weder Zucker noch Milch in seinem Büro. „Was willste wissen?“, fragt er. Als wir darauf zu sprechen kommen, wer ihn in seinem Arbeiten beeinflusst, beginnt er zu strahlen. Albert Ellis, Mitbegründer der kognitiven Verhaltenstherapie. „Die hab‘ ich noch auf Videokassette, wenn du mal reinschauen willst. Die haben noch gearbeitet. Ellis war ein richtiger Draufgänger. Frech, aber schlau“. Ich werde vermutlich nicht zu einer Therapeutin werden, die sich verhält wie Albert Ellis – oder Didi. Provozieren oder paradoxe Interventionen liegen mir nicht. Ich lache gerne mit meinen Patientinnen – aber erst, wenn ich mich hinreichend darauf verlassen kann, dass ich sie nicht beschäme oder verletze. Trotzdem ist Didi ein wichtiges Vorbild für mich geworden.
Zum Teil, weil er mir zeigte, auf wie viele verschiedene Arten und Weisen ein guter therapeutischer Prozess erreicht werden kann. Vor allem aber, weil er mir bewies, wie wichtig es ist, einen eigenen Stil zu finden. Dass es darum geht, sowohl die therapeutische Rolle, als auch die eigene Persönlichkeit zu verstehen und miteinander in Einklang zu bringen. An meinem letzten Praktikumstag kam Didi zu meinem Arbeitsplatz. In der Hand hielt er ein Foto in DIN-A3-Größe. Zu sehen waren über 20 berühmte Forscherinnen auf einer Konferenz in den USA – darunter Watzlawick, Masters, Yalom, Beck und natürlich: der Draufgänger Albert Ellis. Das Poster hängt eingerahmt in meinem ersten eigenen Büro. Irgendwann erzähle ich vielleicht einer Praktikantin davon.
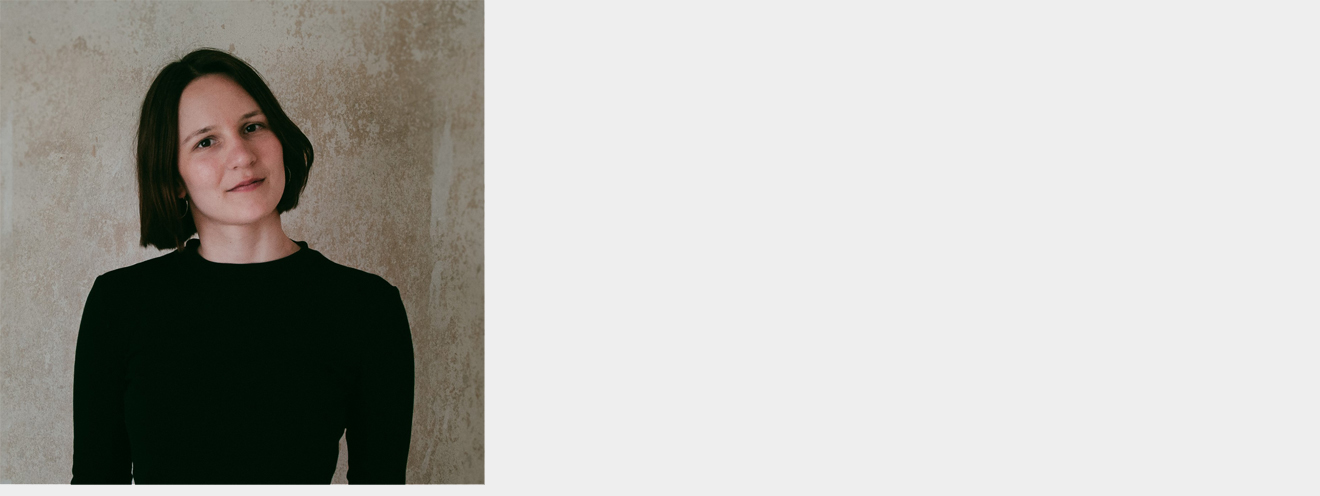

Transparenz-Hinweis:
Es gibt keine Therapeutin ohne Patientinnen – deshalb erzählt diese Kolumne von Menschen in der Psychiatrie. Da der Schutz der Behandelten an oberster Stelle steht, werden die Fallbeispiele bezüglich ihrer soziodemographischen und biografischen Daten stark verändert und erscheinen mit zeitlichem Abstand. Die berichteten Begegnungen bleiben in ihrem emotionalen Kern erhalten.








