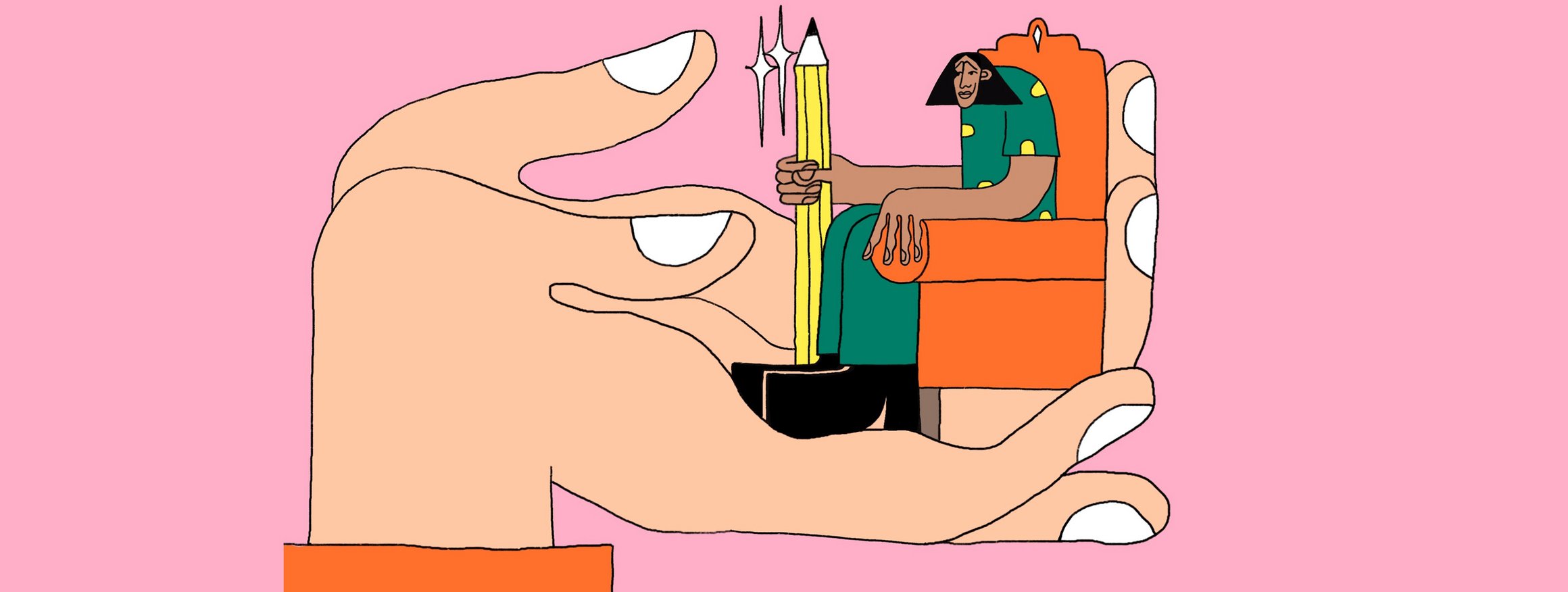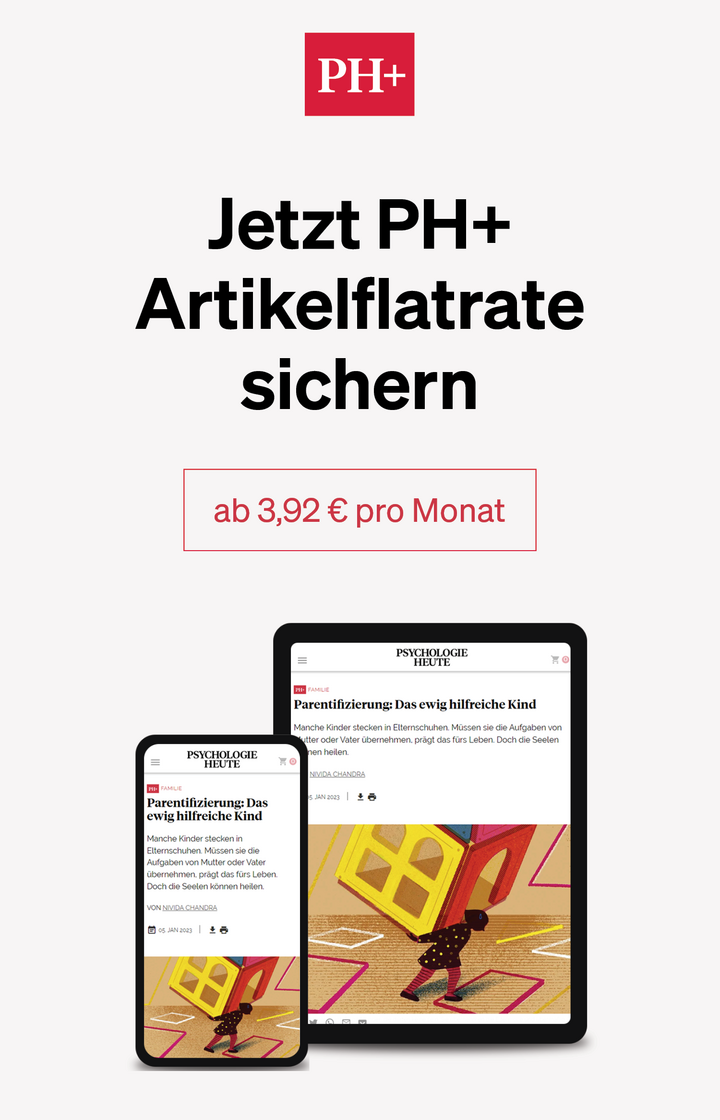In der Regel bewältige ich Veränderungen, indem ich tagträume und mir die Zukunft märchenhaft ausmale. Vor meiner ersten Arbeitserfahrung stellte ich mir mich selbst als gute Therapeutin vor – in eine Strickjacke gehüllt, von einer Aura der Zuversicht und Kompetenz umgeben, mit einer Prise Humor bei der Arbeit. Ich hoffte, dass die Patientinnen mich mögen und gerne mit mir arbeiten würden. Natürlich hatte ich auch Angst, ihnen nicht gerecht zu werden oder helfen zu können. Womit ich allerdings nicht gerechnet hatte, war die Schwierigkeit, zu sehr gemocht zu werden – und ich spreche hier nicht von Verliebtheit.
Mit Frau P. war das von Anfang an so. Sie strahlte, wenn sie mich auf dem Gang sah, machte mir Komplimente für meine Methoden und stellte meine Kompetenz heraus. Für ihre Fortschritte bedankte sie sich überschwänglich. Frau P. hatte eine herausfordernde Kindheit mit unzuverlässigen Eltern durchlebt. Es war überraschend, dass sie mir nicht mit mehr Misstrauen begegnete. Aus den Sitzungen mit Frau P. kam ich jedes Mal mit einem komischen Bauchgefühl. Ich fühlte mich seltsam unfrei, erlebte den Druck, den hohen Erwartungen gerecht werden zu müssen. Andauernd hatte ich Angst, die Person, die so viele Hoffnungen in mich setzte, zu enttäuschen.
Wie ich damit umgehen sollte, wusste ich nicht. Es gibt Themen, die fast allen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (in und mit Ausbildung) Unbehagen bereiten – wie zum Beispiel, sich in Klienten oder Klientinnen zu verlieben (das passiert etwa der Hälfte der Therapeutinnen und etwa 70 Prozent der Therapeuten mindestens einmal während der Berufslaufbahn). Und dann gibt es Themen, die uns aufgrund unserer spezifischen Persönlichkeitseigenschaften und Prägungen unangenehm sind. Ich bin zum Beispiel eine Person, die nach Anerkennung sucht. Um meine Arbeitsbeziehungen nicht zu stören, achte ich gut darauf, dieses Bedürfnis außerhalb meiner therapeutischen Arbeit zu erfüllen. Nun hinterfragte ich aber schamhaft, ob ich womöglich ein so hohes Anerkennungsbedürfnis hatte, dass ich die Patientin unbewusst zur Idealisierung aufforderte.
Seltsamerweise hatte ich nicht den Eindruck, dass Frau P. mir mit ihren Komplimenten schmeicheln wollte. Sie schien sie für sich selbst zu brauchen. Aber wieso?
Es war schließlich ein altes Zitat, das mich auf eine neue Spur brachte. Der Psychiater und Psychoanalytiker Ronald Fairbairn schrieb einmal: „It is better to be a sinner in a world ruled by God than to live in a world ruled by the Devil.“ Er beschrieb, dass Kinder bei schwierigen Konflikten mit ihren Eltern eher sich selbst hinterfragten oder beschuldigten. Er argumentierte, dass es für Kinder leichter sei, sich selbst zu belasten, als ihre wichtigsten Bindungen, ihre gesamte Welt, als einen unsicheren, gefährlichen Ort zu erleben.
Plötzlich puzzelte sich ein ganz neues Bild von meiner Arbeitsbeziehung zu Frau P. zusammen. Sie erlebte sich häufig in Abhängigkeit von anderen, die dadurch auch einen großen Einfluss auf sie hatten. Um das ertragen zu können, musste das Gegenüber eine vollkommen gute, fürsorgliche, Grenzen wahrende Person sein. So möglicherweise auch ich. Eher würde sie sich selbst infrage stellen, als eine meiner Aussagen zu hinterfragen. Ich sah die Gefahr, dass Frau P. mir ihren Therapieerfolg zuschreiben und mit einer unverändert geringen Selbstwirksamkeit die Behandlung verlassen würde.
Ich fing an, anders auf Komplimente von Frau P. zu reagieren. Bedankte sie sich für eine Erkenntnis, sagte ich: „Erst dadurch, dass es Ihnen so gut gelungen ist, sich zu öffnen, konnte ich Ihnen zur Seite stehen. Und die wirkliche Veränderung, die haben sie zwischen unseren Sitzungen erreicht. Sie können stolz auf sich sein.“ Schritt für Schritt wurde unser Kontakt authentischer. Frau P. begann, weniger auf meine Reaktionen zu achten und freier zu sprechen. Sie äußerte sogar Wut darüber, dass es in ihrer Familie tabu gewesen war, sich selbst zu loben und dass sie sich mehr Selbstvertrauen für sich selbst wünsche. Außerdem habe ich von Frau P. auch etwas über mich selbst gelernt: Dass ich durch meine Tagträume meine Zukunft idealisiere, ist ein Weg, ein Gefühl der Sicherheit und Motivation aufzubauen. Letzten Endes kommt uns beiden dann doch die Realität dazwischen – die ohne die Idealisierung oft viel lebendiger und schöner ist, als gedacht.

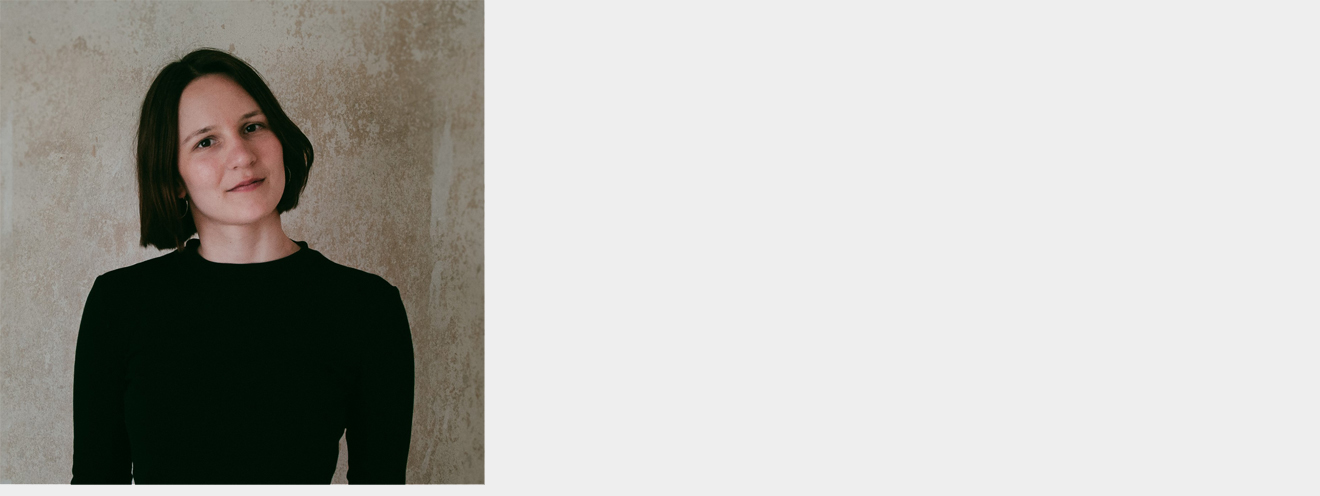
Transparenz-Hinweis: Es gibt keine Therapeutin ohne Patientinnen – deshalb erzählt diese Kolumne von Menschen in der Psychiatrie. Da der Schutz der Behandelten an oberster Stelle steht, werden die Fallbeispiele bezüglich ihrer soziodemographischen und biografischen Daten stark verändert und erscheinen mit zeitlichem Abstand. Die berichteten Begegnungen bleiben in ihrem emotionalen Kern erhalten.