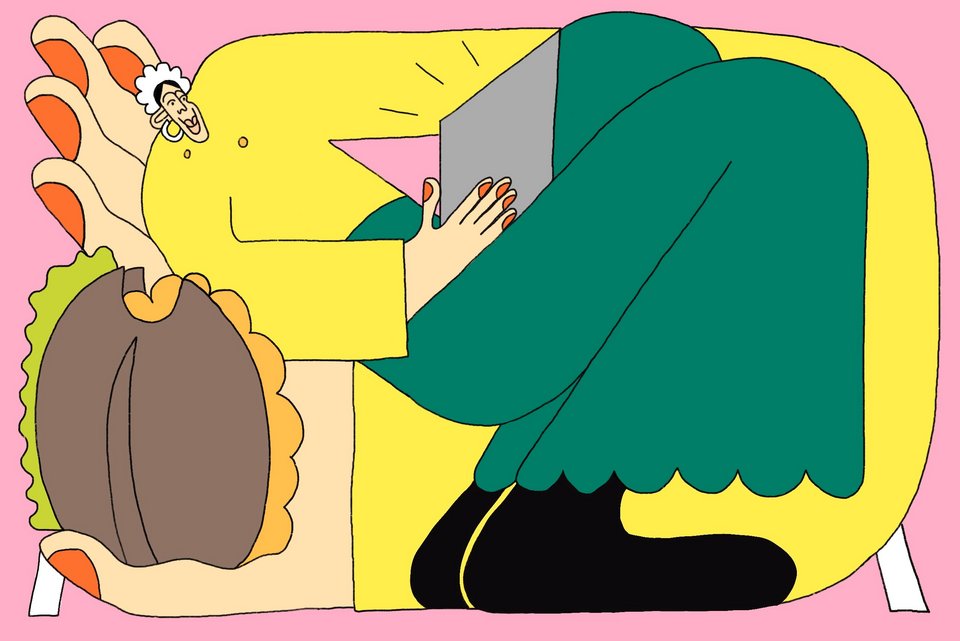Neulich hospitierte ich bei einem Therapeuten, der hervorragend in achtsamkeitsbasierter Therapie ausgebildet war. Seine Methoden waren eindrücklich – sein Lebensstil auch. Er kam früh morgens und ging spät abends. Mittags hielt er ein Schnitzelbrötchen zwischen seinen Zähnen, während er einen Antrag für die Krankenkasse tippte. Einmal trug er verschiedenfarbige Socken. Ein andermal vergaß er, die Klingel der Praxis einzuschalten und wir warteten fünfzehn Minuten auf den ersten Patienten, bevor wir es bemerkten.
In seinen therapeutischen Sitzungen ging es oft um Selbstfürsorge, um eine Tagesstruktur, um Pausen, um Belohnung und Genuss. Er betonte die Wichtigkeit, auf sich Acht zu geben. Ich schmunzelte innerlich, während ich die Sitzung dokumentierte.
An manchen Tagen komme ich nach Hause, schalte meine Lieblingsserie ein und esse zwei Packungen YumYum-Nudeln zum Abendessen. An manchen Tagen streite ich mich mit meinem Partner über kompletten Unsinn. An manchen Tagen schimpfe ich innerlich laut mit mir selbst, anstatt mir eine gute Freundin zu sein.
In solchen Momenten denke ich an meine Patientinnen und frage mich, welche Berechtigung ich eigentlich habe, ihre Therapeutin zu sein. Müsste ich nicht besser auf mich aufpassen?
Aber was heißt das eigentlich? Die wenigsten Sachen lassen sich per se in „gesund“ oder „ungesund“ unterteilen. Ein Schnitzelbrötchen ist keine Absage an die Selbstfürsorge. Ein Schnitzelbrötchen ist ein Schnitzelbrötchen. Entscheidend ist doch: Mit welcher Haltung esse ich es? Denke ich, dass ich keine Pause und kein gutes Essen verdient habe, und habe ich überhaupt keine Kraft mehr, für mich zu kochen? Oder erinnert es mich an Schwimmbadbesuche in der Kindheit? Die Grenze der Gesundheit verläuft nicht zwischen Schnitzelbrötchen und Avocado-Bowl.
Das gilt auch für therapeutische Methoden: Selbst meine Lieblingstechniken halte ich nicht an sich und für jeden Menschen für passend. Ein psychotherapeutischer Ansatz, der mich zum Beispiel sehr überzeugt, ist das Selbstmitgefühl von Kristin Neff. Es bezeichnet einen freundlichen, warmherzigen und achtsamen Umgang mit sich selbst. Eine Aufgabe für mehr Selbstmitgefühl lautet, einen Brief an sich selbst zu schreiben, so, als wäre man die eigene beste Freundin. Die meisten Menschen sind davon berührt und fühlen sich erleichtert. Aber manche berichten mir auch, dass sie das Gefühl haben, sich anzulügen und die lieben Worte nicht verdient zu haben. Sie werden dann noch trauriger. Das lässt sich therapeutisch gut besprechen – ein Geheimrezept für psychische Gesundheit ist die Übung aber nicht.
Es gibt Dinge (wie eine aktivere Alltagsgestaltung), die tun der Forschung nach den meisten Menschen gut. Aber eine Wahrscheinlichkeit ist keine Wahrheit. Menschen sind keine Maschinen, sie reagieren unterschiedlich auf dieselben Methoden und es ist wichtig, offen für sie zu bleiben.
Es kann sehr befreiend sein, sich auch mal „schaden“ zu dürfen. Zu lange wach zu bleiben, weil ich das Staffelfinale meiner Lieblingsserie noch sehen will. Sauer auf die ganze Welt zu sein, obwohl ich eigentlich weiß, dass ich an mir selbst etwas verändern muss.
Wenn jemand in der Gruppentherapie erzählt, den ganzen Samstag nur im Bett gelegen zu haben, dann frage ich mittlerweile manchmal: „Und, hat es Ihnen gefallen?“ Zu meiner Überraschung ist die Antwort selten, aber doch regelmäßig: „Ja.“ Wir Therapeutinnen haben die Deutungshoheit über Gesundheit oder gar „gutem“ Verhalten nicht gepachtet, können nicht darüber urteilen, ohne die Sichtweise der Patientin zu erfragen.
Interessanter ist für mich deshalb die Frage nach Flexibilität. Kann jemand – je nach Situation –, entscheiden, was ihm oder ihr gerade guttut und das auch umsetzen? Weiß die Person, wann sie eine Nudelbox braucht und wann ein frisch gekochtes Essen? Hat sie Ressourcen, sich zu motivieren oder auch um Hilfe zu bitten, wenn sie dazu zu erschöpft ist?
Der chaotische Lehrtherapeut ist beispielsweise nicht nur kompetent in seinem Fach, sondern auch belastbar und fröhlich. Er arbeitet lang, dafür aber nur 4 Tage in der Woche. Am Wochenende fährt er oft zelten. Weil er das liebt. Weil er gesund ist – was immer das bedeuten mag.

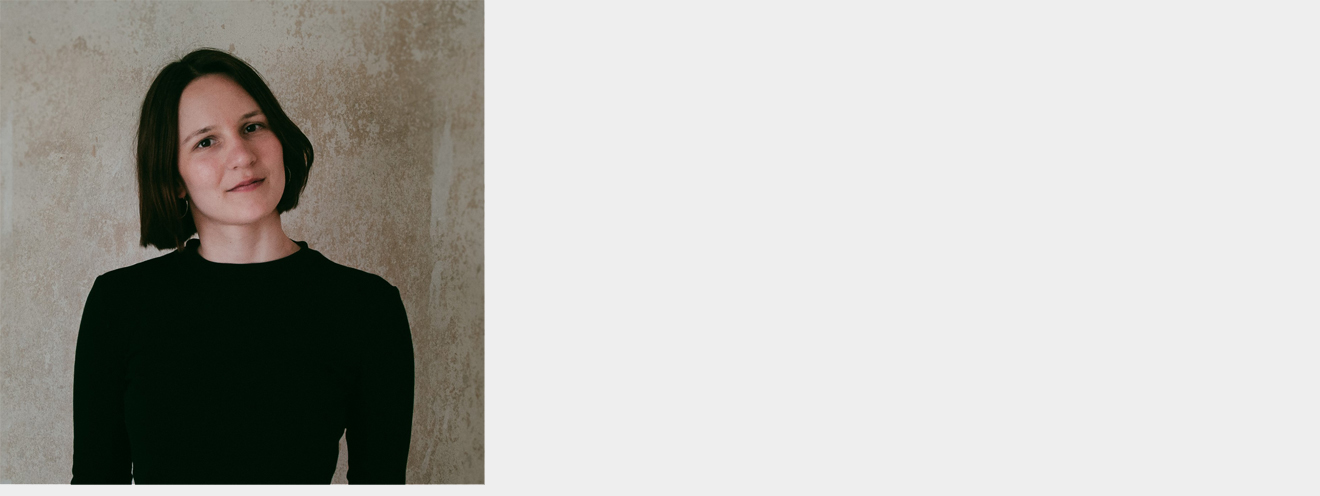
Transparenz-Hinweis: Es gibt keine Therapeutin ohne Patientinnen – deshalb erzählt diese Kolumne von Menschen in der Psychiatrie. Da der Schutz der Behandelten an oberster Stelle steht, werden die Fallbeispiele bezüglich ihrer soziodemographischen und biografischen Daten stark verändert und erscheinen mit zeitlichem Abstand. Die berichteten Begegnungen bleiben in ihrem emotionalen Kern erhalten.