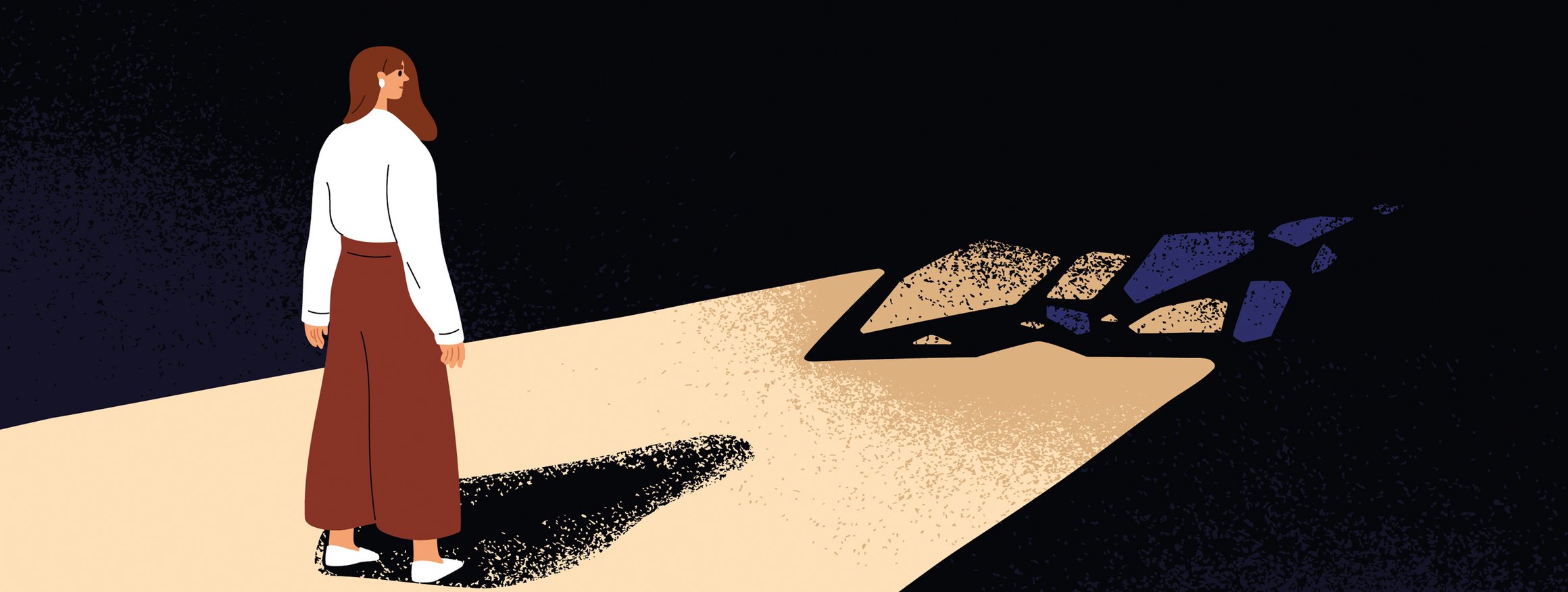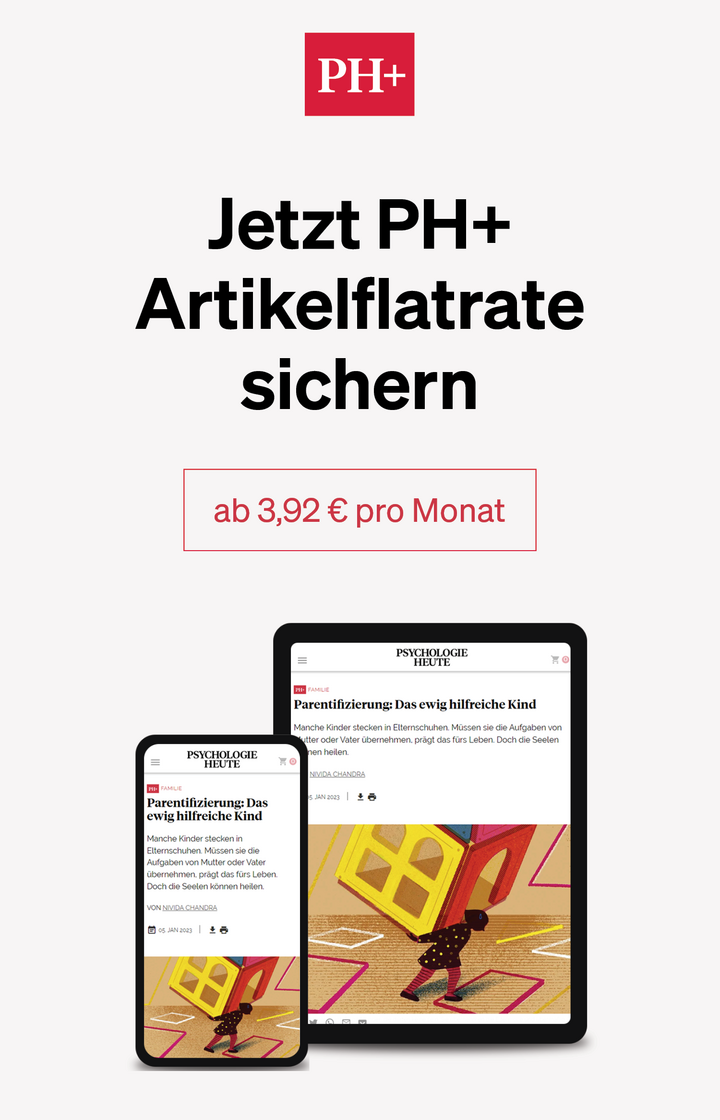Definition Angststörung
Das internationale Krankheits-Klassifikationssystem ICD verwendet den Terminus „Angststörung“ als Oberbegriff für eine Reihe unterschiedlicher psychischer Probleme. Ihnen allen ist gemein, dass die Betroffenen unter starken und wiederkehrenden Ängsten leiden. Diese können durch ein bestimmtes Ereignis ausgelöst werden, von dem aber – wenn überhaupt – nur eine geringe Bedrohung ausgeht. Ein Beispiel für eine solche Situation wäre, dass man eine Spinne erblickt. Man spricht in einem solchen Fall von einer Phobie. Bei einer Panikstörung tritt die Angstattacke dagegen oft wie aus heiterem Himmel auf. Ein konkreter Anlass ist häufig nicht erkennbar, ebenso wenig wie bei der sogenannten generalisierten Angststörung. Bei ihr wird die Angst zum Dauerzustand.
Wie viele Menschen haben eine Angststörung
Angststörungen sind die häufigsten psychischen Erkrankungen. Laut einer Erhebung des Robert-Koch-Instituts durchleben jedes Jahr rund 15 Prozent aller Erwachsenen in Deutschland eine der unterschiedlichen Angststörungen, das sind knapp 10 Millionen Menschen. Frauen sind zwei- bis dreimal so oft betroffen wie Männer.
Unterschied zwischen „normaler“ Angst und einer Angststörung
Angst ist eine tief in unserem Gehirn verankerte Reaktion auf Gefahren. Sie führt zu spezifischen Veränderungen im Organismus, die uns darauf vorbereiten sollen, im Notfall schnell zu handeln – beispielsweise, indem wir fliehen oder kämpfen. Unter anderem wird das sogenannte sympathische Nervensystem aktiviert, und der Körper schüttet Stresshormone wie Adrenalin und Kortisol aus. Diese Signale sorgen dafür, dass das Herz schneller schlägt und sich der Blutdruck erhöht. Die Muskulatur wird besser mit Energie und Sauerstoff versorgt. Funktionen, die in diesem Moment unwichtig sind, werden dagegen heruntergefahren – beispielsweise die Verdauung. Das ist ein Grund, warum Angst uns sprichwörtlich auf den Magen schlägt. Im Normalfall klingen diese Reaktionen wieder ab, sobald die Gefahr vorüber ist.
In bestimmten Situationen Angst zu haben, ist also nicht nur normal, sondern sogar überlebenswichtig. Von einer Angststörung oder Angsterkrankung sprechen Medizinerinnen und Mediziner erst dann, wenn die Angstreaktion unangemessen stark ausfällt, also in keinem Verhältnis zur tatsächlichen Bedrohung steht, wenn sie sehr häufig auftritt und/oder ungewöhnlich lange anhält. Da Angst als äußerst unangenehm empfunden wird, vermeiden die Betroffenen häufig Situationen, die sie auslösen könnten. Das kann zu erheblichen Einschränkungen ihres Alltags führen. Eine genaue Grenze zwischen „normaler“ und „krankhafter“ Angst zu ziehen, ist oft schwierig. Ausschlaggebend ist unter anderem der subjektive Leidensdruck.
Symptome von Angststörungen
Die drei großen Arten von Angststörungen – Panikstörung, Phobie und generalisierte Angststörung – lassen sich klar voneinander abgrenzen. Bei allen Formen treten jedoch starke Ängste auf.
Körperliche Symptome
Angst ist eine starke Stressreaktion. Dabei spult der Organismus ein angeborenes Programm ab, das durch das sympathische Nervensystem gesteuert wird. Es äußert sich in bestimmten körperlichen Symptomen, die allerdings nicht alle auftreten müssen:
Herzrasen
erhöhter Blutdruck
Schwitzen
flacher Atem
angespannte Muskulatur
Zittern
Übelkeit oder Schwindel
Kopfschmerz
Engegefühl oder Schmerz in der Brust
Psychische Symptome
Hinzu gesellen sich psychische Beschwerden. Besonders häufig sind:
Nervosität
Ruhelosigkeit
Sorgen, Gefühle von Bedrohung
Schlafstörungen
Müdigkeit
Gefühle der Scham und der Hilflosigkeit
katastrophisierende Gedanken wie „ich kippe um“, „ich werde verrückt“ oder „ich werde sterben“
Welche Angststörungen gibt es?
Angststörungen lassen sich in drei Gruppen einteilen – Panikstörung, Phobie und generalisierte Angststörung.
Panikstörung
Bei der Panikstörung setzt die Angst plötzlich und wie aus heiterem Himmel ein, oft ohne erkennbaren äußeren Anlass. Während der Attacke kommt es zu vielfältigen körperlichen und psychischen Symptomen, die als extrem dramatisch empfunden werden: Herzrasen oder -stolpern, dem Gefühl zu ersticken, Schmerzen, Taubheit der Gliedmaßen, Ohnmachts- oder Benommenheitsgefühlen, dem Eindruck, dass Dinge unwirklich sind, der Angst, wahnsinnig zu werden oder zu sterben. Oft interpretieren die Betroffenen die körperlichen Beschwerden (etwa das rasende Herz) als Zeichen einer lebensgefährlichen Erkrankung, was die Symptome weiter verstärkt. Meist dauern die Attacken nur wenige Minuten an. In dieser Zeit werden die Symptome immer schlimmer und unerträglicher, bis sie ihren Höhepunkt erreichen. Danach klingen sie wieder ab. Die Betroffenen sind in ständiger Sorge, dass sich der Anfall wiederholen könnte. Diese „Angst vor der Angst“ wird fachsprachlich auch als „Phobophobie“ bezeichnet.
Phobische Störungen
Bei phobischen Störungen gilt die Angst spezifischen Objekten, etwa Spinnen, oder Situationen – ein Beispiel hierfür wäre die Höhenangst. Die Betroffenen versuchen, diesen Auslösern aus dem Weg zu gehen; sie zeigen also ein ausgeprägtes Vermeidungshalten. Ist das nicht möglich, geraten sie in Panik. Oft ängstigt sie schon allein die Vorstellung, die gefürchtete Situation könnte eintreten. In der Psychologie spricht man auch von „Erwartungsangst“. Sie ist – wie das Vermeidungsverhalten –charakteristisch für Phobien. Die Phobischen Störungen teilen sich in drei Untergruppen auf.
Agoraphobie: Unter ihr versteht man die Angst vor Situationen, in denen eine Flucht schwer möglich wäre oder peinliches Aufsehen erregen würde: in der Warteschlange im Supermarkt, im Fahrstuhl, im Kino, in öffentlichen Verkehrsmitteln. In schweren Fällen kann die Agoraphobie dazu führen, dass die Betroffenen kaum noch ihre Wohnung verlassen. Die Platzangst, also die Angst vor großen, freien Plätzen, ist eine Sonderform der Agoraphobie.
Die Ursache einer Agoraphobie ist oft – aber nicht immer – eine Panikattacke, die die Betroffenen an dem jeweiligen Ort erlebt haben. Nach einer solchen Attacke entwickelt sich häufig eine Agoraphobie. Agoraphobikern hilft es in der Regel, die entsprechende Situation in Begleitung von Freundinnen oder Bekannten oder sogar Haustieren wie einem Hund aufzusuchen.
Soziale Phobie: Menschen mit einer sozialen Phobie haben vor Situationen Angst, in denen sie im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen – etwa, wenn sie eine Rede halten sollen, andere nach dem Weg fragen müssen, Behördengänge absolvieren oder ein Date haben. Ihr zugrunde liegt die übermäßige Befürchtung, sich zu blamieren und von Mitmenschen negativ bewertet oder abgelehnt zu werden. Die Betroffenen sind oft schüchtern und kontaktscheu. In schweren Fällen vermeiden sie soziale Situationen, wo es eben geht, und vereinsamen dadurch mehr und mehr.
Spezifische Phobie: Hierzu zählen etwa Ängste vor bestimmten Tieren, zum Beispiel Spinnen oder Katzen, vor Körpersubstanzen, etwa Erbrochenem oder Blut, oder vor ganz spezifischen Situationen wie Gewittern, einem Aufenthalt in der Höhe oder engen Räumen. Letzteres wird auch als Klaustrophobie bezeichnet. Fast jede Situation oder jedes Objekt kann Gegenstand einer spezifischen Phobie sein, so gibt es zum Beispiel auch Berichte von Menschen, die sich vor Knöpfen fürchten.
Generalisierte Angststörung
Bei der generalisierten Angststörung wird die Angst zum ständigen Begleiter. Typische Anzeichen sind ständige Anspannung, Nervosität, Konzentrations- und Schlafstörungen. Dazu gesellen sich körperliche Angst-Symptome wie Zittern, Herzklopfen, Muskelverspannungen oder Schwindel. All diese Merkmale treten nicht anfallsmäßig auf, sondern sind praktisch immer vorhanden, auch wenn ihre Stärke wechseln kann.
Fragt man die Betroffenen, was sie eigentlich genau befürchten, können sie das häufig gar nicht genau benennen. Ihre Ängste sind diffus. Manche Menschen mit einer generalisierten Angststörung sind aber auch in permanenter Sorge, dass Familienmitglieder oder sie selbst erkranken oder verunglücken könnten. Auch die Tatsache ihrer eigenen Angst empfinden sie oft als besorgniserregend. Sie fürchten zum Beispiel, dadurch dauerhaft psychisch zu erkranken. Man spricht in diesem Zusammenhang von „Meta-Sorgen“.
Diese Angststörungen kommen besonders oft vor
Die häufigsten Angststörungen sind die spezifischen Phobien. Ihre sogenannte Jahresprävalenz, das heißt die Zahl der Menschen, die im Laufe eines Jahres unter dieser Erkrankung leiden, liegt in Deutschland bei gut 10 Prozent. Dahinter folgen mit 4 Prozent die Agoraphobie und mit 2,7 Prozent die soziale Phobie. Generalisierte Angststörung und Panikstörung kommen jeweils auf rund 2 Prozent. Frauen sind je nach Art der Störung zwei- bis dreimal so häufig betroffen wie Männer.
Ursachen und Entstehung einer Angststörung
Angststörungen sind eine ins Krankhafte übersteigerte Form ganz natürlicher Furchtreaktionen. Der angeborene Warnmechanismus vor Bedrohungen lässt sich bei den Betroffenen zu leicht oder zu stark aktivieren. Der Grund dafür ist bislang noch nicht vollständig bekannt. Vermutlich spielen verschiedene Faktoren zusammen.
Biologische Faktoren: Rolle von Genetik und Nervensystem
Angststörungen haben eine genetische Komponente, daher treten sie familiär gehäuft auf. Zwillingsstudien zufolge liegt die Erblichkeit der generalisierten Angststörung bei 35 Prozent, die der Panikstörung und sozialen Phobie bei etwa 50 bis 60 Prozent. Die restlichen 40 bis 65 Prozent werden durch ungünstige Umweltfaktoren wie Stress erklärt.
Die Störungen zählen zu den sogenannten komplex-genetischen Erkrankungen: Ihre Entstehung wird nicht durch eine einzelne Erbanlage, sondern durch das Zusammenspiel einer ganzen Reihe von Genvarianten begünstigt. Der Beitrag jeder einzelnen Variante zum Krankheitsrisiko ist dabei gering; daher ist es auch schwierig, die beteiligten Erbanlagen zu identifizieren.
Die Genvarianten beeinflussen vermutlich die Funktionsweise des Gehirns. Die für Angst charakteristischen psychischen und körperlichen Symptome entstehen durch das Zusammenwirken verschiedener Zentren in unserem Denkorgan. Eine wichtige Rolle spielt dabei der sogenannte Mandelkern, auch bekannt als Amygdala. Er sendet Stresssignale aus und aktiviert dadurch andere Hirnregionen. Dieses Angstnetzwerk scheint bei Betroffenen gestört, es reagiert zum Beispiel auf bestimmte Reize mit stärkerer Aktivität.
Die Nervenzellen im Gehirn nutzen Botenstoffe, um Informationen auszutauschen, die sogenannten Neurotransmitter. Dazu zählen etwa Serotonin, Noradrenalin und Gamma-Aminobuttersäure (GABA). Bei Patientinnen und Patienten mit einer Angststörung ist häufig das Gleichgewicht dieser und anderer Botenstoffe verändert. Die verfügbaren Medikamente setzen an diesem Punkt an: Sie sollen den Neurotransmitter-Spiegel normalisieren.
Psychologische Faktoren
Lerntheoretische Ansätze: Die Lerntheorie geht davon aus, dass krankhafte Ängste durch Konditionierungsprozesse entstehen. Dabei wird ein neutraler, eigentlich harmloser Reiz mit einem angstauslösenden Reiz verknüpft – ein Vorgang, der klassische Konditionierung genannt wird. Ein Beispiel: Beim Fahrstuhlfahren kommt es zu einem Stromausfall; die Lichter erlöschen, und es geht zehn Minuten nicht weiter. Diese unangenehme Erfahrung, der angstauslösende Reiz, wird nun mit dem Fahrstuhlfahren, dem neutralen Reiz, verknüpft. Hinzu kommt ein weiterer Prozess, die operante Konditionierung. Darunter versteht man Verhaltensänderungen, die durch Erfahrungen erlernt werden. In dem eben geschilderten Beispiel bewirkt die Konditionierung, dass die Betroffenen Fahrstühle künftig meiden. Dadurch können sie die gemachte Negativerfahrung nicht korrigieren, und die Angst verfestigt sich.
Auch das Verhalten von Anderen kann zu einer Angstkonditionierung führen – wenn etwa ein Elternteil panisch auf Wespen reagiert. Die heute gültigen Modelle gehen zudem davon aus, dass das „Erlernen“ von Ängsten besonders leicht erfolgt, wenn der entsprechende Stimulus in der menschlichen Stammesgeschichte tatsächlich einmal eine Bedrohung war. Bei Schlangen ist dies zum Beispiel der Fall.
Kognitive Theorie: Die kognitive Theorie geht unter anderem auf Arbeiten des US-amerikanischen Psychiaters Aaron Beck zurück. Sie besagt vereinfacht gesagt, dass übersteigerte Angst eine Folge fehlerhafter Vorstellungen, Gedanken und Interpretationen ist. Das lässt sich etwa am Beispiel von Panikstörungen illustrieren. Bei ihr werden körperliche Symptome wie Atemlosigkeit oder ein schneller Herzschlag zum Beispiel als Zeichen eines drohenden Herzinfarkts interpretiert. Diese „Katastrophen-Gedanken“ und die durch sie ausgelösten Gefühle der Angst sorgen dafür, dass der Atem noch flacher wird und sich der Puls noch mehr beschleunigt. Gleichzeitig verstärkt sich die Aufmerksamkeit auf diese Symptome. Dadurch entsteht eine Abwärtsspirale, die in einer Panik-Attacke gipfelt.
Ziel therapeutischer Ansätze ist es, diese Fehlvorstellungen zu korrigieren und den Teufelskreis der Angst zu durchbrechen. Tatsächlich ist ein bestimmtes Gebiet der Hirnrinde im Bereich der Stirn, der sogenannte präfrontale Kortex, dazu in der Lage, die Amygdala zu beeinflussen: Wenn der präfrontale Kortex eine Situation als ungefährlich bewertet, wird dadurch das Angstnetzwerk gehemmt und die Angstreaktion reduziert. Allerdings zeigen Studien, dass Ängste auch dann ausgelöst werden können, wenn wir den entsprechenden Reiz, etwa ein wutverzerrtes Gesicht, gar nicht bewusst wahrnehmen. Forschende gehen daher davon aus, dass sie einer kognitiven Kontrolle nur begrenzt zugänglich sind.
Individuelle Vulnerabilitätsfaktoren: Es gibt bestimmte psychologische Faktoren, die das Risiko für eine Angststörung erhöhen. Dazu zählen beispielsweise die Persönlichkeitseigenschaften Introversion und Neurotizismus, aber auch individuelle Eigenheiten der Informationsverarbeitung. Manche Menschen neigen zum Beispiel dazu, ihre Umgebung sehr stark nach möglichen Gefahren abzuscannen. Andere haben eine hohe Sensibilität für die eigenen Körperreaktionen wie die Geschwindigkeit ihres Herzschlages, was dazu führen kann, dass sie diese Signale stärker wahrnehmen und möglicherweise als Zeichen einer Gefahr fehlinterpretieren.
Soziokulturelle Faktoren: Einfluss von Erziehung, Umweltfaktoren und Lebensereignissen
Die Entstehung einer Angststörung wird vermutlich durch bestimmte frühe Lebenserfahrungen begünstigt. Dazu zählt beispielsweise der Tod eines Elternteils, eine längere Trennung von Vater oder Mutter, Kindesmisshandlung oder -missbrauch. Auch belastende Ereignisse im Erwachsenenalter, beispielsweise eine Scheidung, die Pflege eines nahen Angehörigen oder beruflicher Stress, gehen mit einem erhöhten Erkrankungsrisiko einher. Es gibt zudem Hinweise darauf, dass der Erziehungsstil einen Einfluss hat. So leiden Kinder abweisender Eltern später im Leben häufiger unter Ängsten. Einen ähnlichen Effekt kann auch eine überbeschützende Erziehung haben. Das liegt vermutlich daran, dass die Betroffenen seltener angsteinflößende Situationen erleben und durchstehen. Ein niedriges Bildungsniveau oder belastende Lebensumstände wie Arbeitslosigkeit gehen ebenfalls mit einem höheren Erkrankungsrisiko einher. Die Richtung der Kausalität ist bei diesen Zusammenhängen aber oft unklar: Erkranken Arbeitslose öfter an Angststörungen? Oder werden Menschen mit Angststörungen öfter arbeitslos?
Einen ähnlichen Effekt kann auch eine überbeschützende Erziehung haben. Das liegt vermutlich daran, dass die Betroffenen seltener angsteinflößende Situationen erleben und durchstehen. Ein niedriges Bildungsniveau oder belastende Lebensumstände wie Arbeitslosigkeit gehen ebenfalls mit einem höheren Erkrankungsrisiko einher. Die Richtung der Kausalität ist bei diesen Zusammenhängen aber oft unklar: Erkranken Arbeitslose öfter an Angststörungen? Oder werden Menschen mit Angststörungen öfter arbeitslos?
Wie werden Angststörungen diagnostiziert?
Angststörungen werden mitunter erst spät erkannt. Grund dafür ist, dass viele Betroffene bei der Diagnose in erster Linie körperliche Symptome wie Herzrasen oder Schlafstörungen nennen und nicht die Angst als solche. Daher fragen Ärztinnen und Ärzte bei Verdacht gezielt nach übersteigerten Befürchtungen oder Ängsten sowie nach den Umständen, unter denen sie auftreten. Dabei können standardisierte Fragebögen wie das Beck-Angst-Inventar (BAI) helfen. Manchmal hat Angst auch organische Gründe. So können Angina pectoris, Asthma-Anfälle oder Schilddrüsen-Fehlfunktionen mit Panik oder Ängsten einhergehen. Bei der Diagnostik versucht man, diese Ursachen auszuschließen.
Häufig Begleiterkrankungen einer Angststörung
Menschen mit Angststörungen leiden oft noch unter weiteren Erkrankungen. Dazu zählen vor allem:
Suchterkrankungen (Alkohol- oder Medikamenten-Missbrauch)
Zwangsstörungen
Sogenannte „Somatoforme Störungen“, also diffuse körperliche Beschwerden wie Schwindel, Rücken- oder Kopfschmerzen
Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Schilddrüsenerkrankungen
Asthma
Allergien
Damit ist nicht gesagt, dass die Angst diese Begleiterkrankungen verursacht. Zwar ist Alkohol kurzfristig angstlösend, was erklären könnte, warum Betroffene eher zur Flasche greifen. Andererseits kann Alkoholmissbrauch Ängste auslösen oder verstärken. Letzteres gilt auch für Überfunktionen der Schilddrüse oder asthmatische Beschwerden.
Bewährte Methoden bei der Behandlung einer Angststörung
Werden Angststörungen nicht behandelt, können sie sich mehr und mehr verfestigen und auf weitere Lebensbereiche ausdehnen. Dadurch steigt das Risiko von Begleitsymptomen wie dem Missbrauch von Alkohol oder Beruhigungsmitteln. Durch eine Therapie, Medikamente oder Selbsthilfe-Maßnahmen lassen sich krankhafte Ängste in der Regel gut in den Griff bekommen.
Psychotherapie
Als eine der wirksamsten Behandlungsmethoden gilt die kognitive Verhaltenstherapie. Sie umfasst verschiedene Bausteine. Dazu zählen etwa kognitive Verfahren, bei denen die Betroffenen lernen, sich von Katastrophen-Gedanken wie „ich werde sterben“ abzulenken, aber auch von Fehlinterpretationen wie der, dass das Herzstolpern ein Zeichen eines Infarkts ist. Außerdem sollen sie alternative Gedanken entwickeln. Auch die Psychoedukation ist ein wichtiges Element. Darunter versteht man die Aufklärung über Entspannungstechniken, über günstige Verhaltensweisen wie Sport und über ungünstige wie Vermeidung oder Alkoholkonsum. Die kognitive Verhaltenstherapie hat sich bei allen Arten von pathologischen Ängsten bewährt. Welche Verfahren sie genau umfasst, hängt von der Art der Störung ab.
So werden die oben genannten Maßnahmen bei einer Agoraphobie oder anderen Phobien meist mit einer Expositions- oder Konfrontationstherapie kombiniert. Dabei üben Betroffene, sich angstauslösenden Situationen gezielt auszusetzen. Das geschieht in der Regel schrittweise – bei einer Spinnenphobie sehen sich Patientinnen und Patienten etwa zunächst Bilder von Spinnen an, irgendwann dann echte Spinnen, schließlich berühren sie die Tiere. Die Betroffenen machen bei diesem Prozess die Erfahrung, dass von der gefürchteten Situation keine Gefahr ausgeht. Dadurch erfolgt eine Art „Umkonditionierung“: Die phobischen Reize werden als immer weniger beängstigend empfunden.
Eine weitere häufig genutzte Behandlungsmethode ist die psychodynamische Psychotherapie. Unter diesem Begriff werden tiefenpsychologisch fundierte und psychoanalytische Verfahren zusammengefasst. Sie gehen davon aus, dass psychische Probleme eine Folge unbewusster Gefühle und Konflikte sind. Ziel der psychodynamischen Therapien ist es, diese Spannungen aufzuspüren und bewusst zu machen, um sie besser verstehen und verarbeiten zu können. In der Folge soll es zu einer Abnahme der Störungssymptome kommen. Die Wirksamkeit dieser Ansätze ist bei Angststörungen schlechter belegt als die der kognitiven Verhaltenstherapie. Dennoch werden auch diese Ansätze in der aktuellen Behandlungsleitlinie empfohlen – vor allem dann, wenn eine kognitive Verhaltenstherapie nicht angeschlagen hat oder wenn die Betroffenen psychoanalytische Verfahren bevorzugen.
Behandlung mit Medikamenten
Angststörungen lassen sich gut durch bestimmte Gruppen von Depressions-Medikamenten behandeln. Dazu zählen insbesondere die Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) und die Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (SNRI). Sie sorgen dafür, dass sich der Spiegel der Botenstoffe im Gehirn normalisiert. Es dauert in der Regel zwei bis sechs Wochen, bis die Wirkung eintritt. Die Behandlung wird nach Abklingen der Angstsymptome in der Regel noch sechs bis zwölf Monate fortgeführt, um die Gefahr eines Rückfalls zu verringern. Zudem werden die Pharmaka nicht abrupt abgesetzt, sondern langsam „ausgeschlichen“. Bei der Behandlung können Nebenwirkungen wie Übelkeit, Verstopfung, Schlafstörungen oder sexuelle Unlust auftreten.
Bei starken akuten Ängsten, wie sie etwa bei Panikstörungen auftreten, ist auch die Behandlung mit bestimmten angstlösenden Präparaten denkbar, den Benzodiazepinen, beispielsweise Valium. Sie dämpfen Ängste schnell und effektiv. Wegen der Gefahr einer Abhängigkeit rät die aktuelle Behandlungsleitlinie aber dazu, diese Wirkstoffe nur in Ausnahmefällen und kurzzeitig einzusetzen.
Von Sport bis Selbsthilfegruppe: Weitere Behandlungsmethoden
Es gibt eine Reihe weiterer Methoden, die sich bei der Behandlung von Ängsten als wirksam erwiesen haben. Dazu zählen beispielsweise regelmäßiger Ausdauersport, etwa dreimal in der Woche joggen oder schwimmen. Die körperliche Betätigung sorgt dafür, dass Stresshormone abgebaut werden, und sie wirkt stimmungsaufhellend.
Auch Entspannungstechniken können dabei helfen, Stress und Anspannung zu verringern. Durch sie werden Angstattacken seltener und die allgemeine Unruhe und Besorgnis nimmt ab. Eine Technik, die vielen Menschen hilft, ist die progressive Muskelentspannung (PME). Dabei lernen Betroffene, Muskelgruppen gezielt zu entspannen. Auch dadurch reduzieren sich Ängste und Sorgen. Als gut wirksam gelten außerdem Achtsamkeitsverfahren. Dabei trainieren Betroffene, im Hier und Jetzt zu bleiben, und entziehen so Katastrophengedanken den Boden. Gleichzeitig lernen sie, ihre Ängste zu akzeptieren und sie nicht durch die ständige Beschäftigung mit ihnen weiter zu stärken.
Vielen Betroffenen hilft zudem der Austausch mit anderen, denen es ebenso geht wie ihnen. In Selbsthilfegruppen merken sie, dass sie mit ihren Ängsten nicht allein sind; sie erhalten Informationen und motivieren sich gegenseitig, den Kampf gegen ihre Sorgen aufzunehmen. In eine ähnliche Richtung zielen Selbsthilfe-Broschüren. Sie enthalten oft auch Anleitungen zu Angst-Konfrontationsübungen im Alltag und können so gegebenenfalls eine kognitive Verhaltenstherapie unterstützen.
Auch eine gesunde Ernährung kann vermutlich das Risiko von Angststörungen verringern. So deuten Studien darauf hin, dass Nahrungsmittel mit einem hohen Gehalt an Omega-3-Fettsäuren möglicherweise schützend wirken. Dazu zählen etwa Walnüsse oder bestimmte Fische wie Lachs. Ähnliches gilt für Spurenelemente wie Selen und Zink oder für Vitamin D. Eine fett- und zuckerreiche Kost, künstliche Süßstoffe und ein Mangel an der Aminosäure Tryptophan scheinen es dagegen wahrscheinlicher zu machen, dass pathologische Ängste auftreten.
Allerdings sind diese Befunde in vielen Fällen nicht gut abgesichert. Gerade der Nutzen von Nahrungsergänzungsmitteln wie Vitaminen oder Spurenelementen ist in vielen Fällen fraglich: Einerseits helfen sie meist nur denen, die einen Mangel an diesen Nährstoffen haben. Andererseits birgt die Einnahme mancher Präparate – beispielsweise von Vitamin D oder Selen –Gesundheitsrisiken; sie sollte daher nur nach Absprache mit einem Arzt erfolgen.
Generell gilt, dass eine ausgewogene Ernährung mit viel Obst und Gemüse, viel Vollkorn, wenig Fett und wenigen der leichtverdaulichen Kohlenhydrate den Nährstoff-Bedarf in den meisten Fällen ausreichend decken sollte. Wer sich langfristig auf diese Weise ernährt und außerdem auf ausreichend Bewegung achtet, tut etwas für seine körperliche Gesundheit und beugt vermutlich auch Erkrankungen wie Depressionen, Demenz oder Angststörungen vor.
Prävention einer Angststörung
Bei einem hohen Stressniveau steigt das Risiko von Angststörungen. Daher können Methoden, die dem Stressabbau dienen, präventiv wirken. Dazu zählen vor allem Sport und Entspannungstechniken. Inzwischen gibt es auch spezielle Vorbeugungsprogramme für gefährdete Kinder und Jugendliche.
Vorbeugung für Risikogruppen
Programme wie „Cool Little Kids“ der Macquarie Universität in Sidney oder „Mutig werden mit Til Tiger“ richten sich an sehr schüchterne, sozial unsichere oder ängstliche Kinder. Diese tragen ein erhöhtes Risiko, später im Leben eine Angststörung zu entwickeln. Die Angebote zielen darauf ab, den Jungen und Mädchen mehr Selbstvertrauen in sozialen Situationen zu geben. Die Eltern lernen, wie sie ihre Kinder entsprechend fördern können. Erste Studien dokumentieren, dass solche Programme das Risiko von Angststörungen langfristig reduzieren können.
Ratschläge für Betroffene und Angehörige
Wenn pathologische Ängste nicht behandelt werden, können sie sich verfestigen und auf immer mehr Lebensbereiche ausdehnen. Das kann einerseits zu erheblichen Einschränkungen des Alltags führen. Andererseits kann sich dadurch das Risiko von Begleiterkrankungen wie Depressionen oder von Alkohol- oder Medikamentenmissbrauch erhöhen. Wer wiederholt unter Panikattacken leidet, über mehrere Wochen hinweg von diffusen Ängsten geplagt wird oder bestimmte, eigentlich ungefährliche Alltagssituationen als bedrohlich empfindet und ihnen zunehmend aus dem Weg geht, der sollte eine Ärztin oder einen Therapeuten aufsuchen.
Als Angehörige oder Angehöriger sollten Sie der betroffenen Person nicht zu viele unangenehme Tätigkeiten abnehmen, da Sie das Vermeidungsverhalten dadurch möglicherweise verstärken. Besser wäre es, den Betroffenen zu ermutigen, angstbesetzte Situationen zunehmend wieder allein und ohne Ihre Begleitung zu bewältigen. Sie sollten sich zudem über Entstehung, Auslöser und Behandlung von Angststörungen informieren. So können Sie besser verstehen, was der Erkrankte durchmacht und wodurch Sie ihm am besten helfen können.
Fünf häufig gestellte Fragen zu Angststörungen
1. Ist eine Angststörung eine Depression?
Nein. Menschen mit einer Angststörung tragen jedoch ein erhöhtes Risiko, zusätzlich an einer Depression zu erkranken. Außerdem können auch bei Depressionen Ängste auftreten. Dennoch sind die beiden Krankheiten nicht identisch: Während bei Angststörungen die Sorgen und Ängste eindeutig im Vordergrund stehen, sind es bei Depressionen eher Symptome wie Niedergeschlagenheit, innere Leere, der Verlust von Interessen und ständige Müdigkeit.
2. Kann eine Angststörung geheilt werden?
Angststörungen sprechen in der Regel gut auf eine Behandlung an. Häufig verschwinden die Symptome sogar ganz. Bei Panikstörungen ist das bei zwei Dritteln aller Betroffenen der Fall, bei der generalisierten Angststörung und der sozialen Phobie etwas seltener. Allerdings kann die Störung auch nach Jahren ohne Angstsymptomatik wieder ausbrechen. Eine endgültige Heilung ist relativ selten.
3. Ist eine Angststörung gefährlich?
Ja. Wird eine Angststörung nicht behandelt, kann sie sich verstärken und den Alltag gravierend beeinträchtigen. Außerdem erhöht sich das Risiko von Begleiterkrankungen wie etwa der Depression oder einer Alkoholsucht.
4. Ab wann sind Angstzustände krankhaft?
Eine scharfe Grenze gibt es nicht. Ausschlaggebend für die Bewertung ist der individuelle Leidensdruck. Kurz gesagt: Wenn Ängste so häufig und so stark auftreten, dass sie das Wohlbefinden im Alltag deutlich einschränken, könnte eine behandlungsbedürftige Angststörung vorliegen.
5. Was ist die 10-Sätze-Methode?
Die 10-Sätze-Methode wurde von dem Journalisten und Heilpraktiker Klaus Bernhardt entwickelt, sie soll positive Gefühle stärken und die Spirale der Angst durchbrechen. Wissenschaftliche Belege für ihre Wirksamkeit fehlen weitgehend.
Quellen
David M. Clark: A cognitive approach to panic. Behaviour Research and Therapy, 24/4, 1986, 461–470
Ronald M. Rapee u. a.: Altering the trajectory of anxiety in at-risk young children. American Journal of Psychiatry, 167/12, 2010, 1518–1525
Brenda WJH Penninx u. a.: Anxiety disorders. The Lancet, 397/10277, 2021, 914–927
Monique Aucoin u. a.: Diet and anxiety: a scoping review. Nutrients, 13/12, 2021, 4418
Nicholas G. Norwitz, Uma Naidoo: Nutrition as metabolic treatment for anxiety. Frontiers in Psychiatry, 12, 2021, 598119
O. Hobart Mowrer: On the dual nature of learning – a re-interpretation of „conditioning“ and „problem-solving“. Harvard Educational Review, 17, 1947, 102–148
Dietmar Hansch: Panik & Platzangst selbst bewältigen: das Praxisbuch. Knaur MensSana 2021 (1. Auflage)
F. Jacobi u. a.: Prevalence, co-morbidity and correlates of mental disorders in the general population: results from the german health interview and examination survey (ghs). Psychological Medicine, 34/4, 2004, 597–611
F. Jacobi u. a.: Psychische Störungen in der Allgemeinbevölkerung. Der Nervenarzt, 85/1, 2014, 77–87
F. V. A. van Oort u. a.: Risk indicators of anxiety throughout adolescence: the trails study. Depression and Anxiety, 28/6, 2011, 485–494
S3-Leitlinie Angststörungen. Springer 2015
Martina M. Fischer-Klepsch: Soziale Phobie - die heimliche Angst: Selbsthilfeprogramm mit Übungen aus der Praxis. Junfermann 2021
Michael Rufer, Heike Alsleben, Angela Weiss: Stärker als die Angst: ein Ratgeber für Menschen mit Angst- und Panikstörungen und deren Angehörige. Hogrefe 2023 (3., überarbeitete Auflage)
Arne Öhman, Stefan Wiens: The concept of an evolved fear module and cognitive theories of anxiety. In: Antony S. R. Manstead u. a. (Hg.): Feelings and Emotions. Cambridge University Press 2004 (1. Auflage), 58–80
Simona Scaini u. a.: The cool kids as a school-based universal prevention and early intervention program for anxiety: results of a pilot study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19/2, 2022, 941