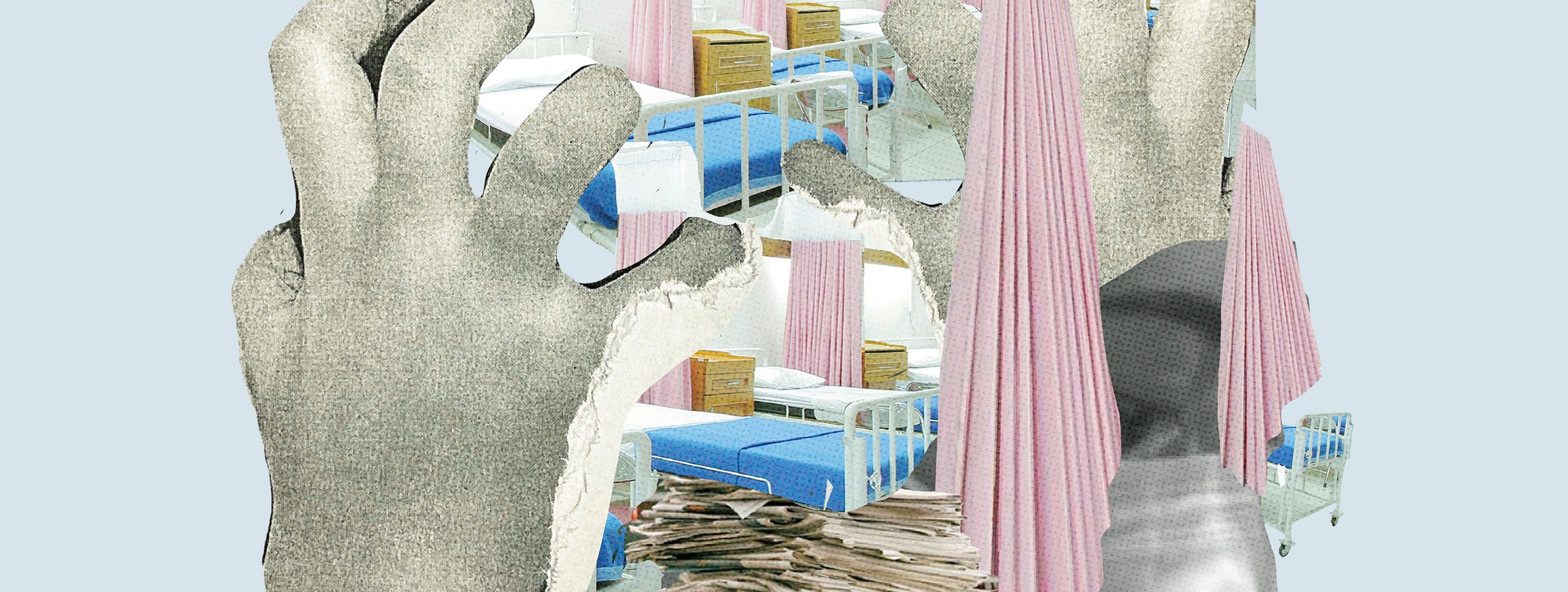Zu Schichtbeginn mache ich mir im Kopf eine Liste: Was steht heute an? Was muss ich tun? Dann geht es los. Körperpflege, Medikamentengabe. Wie weit ich komme, wird sich zeigen.
Direkt nach meiner Pflegeausbildung habe ich auf der Intensivstation angefangen. Das war 2020: Corona, 12-Stunden-Schichten, wir waren überbelegt und unterbesetzt. So ist es zum Glück heute nicht mehr. Trotzdem arbeiten wir häufig unter Zeitdruck.
Auf unserer Intensivstation liegen Menschen mit Krankheitsbildern von Knochenbrüchen über Darmverschluss bis Lungenversagen. Pro Schicht bin ich für zwei von ihnen verantwortlich. Es klingt wenig, aber die Pflege ist aufwendig, und wir wissen nie, was noch kommt. Innerhalb von Sekunden kann es einem von ihnen schlechter gehen oder im Krankenhaus ein weiterer Notfall auftreten.
„Wie geht es Ihnen?“ Dann ist die Zeit schon vorbei
Es gibt Tage, an denen ich acht Stunden lang am Bett im Einsatz bin, zwischendurch nur kurz einen Schluck trinke, auf Toilette gehe. Essen fällt aus. Trinken kommt sowieso zu kurz, weil wir so viel hin und her laufen. So 10000 Schritte pro Schicht schaffe ich locker, das sehe ich auf meiner Fitnessuhr.
Mehr Personal würde natürlich helfen, aber der Bedarf ist schwer einzuschätzen. An einem Tag sind wir gut besetzt und haben nur stabile Patienten. Am nächsten Tag sind wir unterbesetzt und es treten zwei Notfälle auf. Wenn zum Beispiel jemand auf einer anderen Station einen Herzinfarkt hat, klingelt bei uns ein Telefon, und ein Team aus einer Ärztin oder einem Arzt und einer Pflegefachperson macht sich sofort auf den Weg. Das reißt eine riesige Lücke in meinen Zeitplan, denn der Notfallpatient muss nicht nur untersucht werden, sondern auch auf die Intensivstation verlegt und weiterversorgt. Alle To-dos sind hinfällig und es kommen zehn neue hinzu. Ich muss die Liste in meinem Kopf sofort anpassen, alle Aufgaben neu priorisieren.
Zum Ende der Schicht habe ich oft noch einen Berg von Aufgaben vor mir und die Zeit läuft mir davon. Ich sehe, dass ich nicht mehr alles schaffen kann, und sortiere die Liste in meinem Kopf wieder neu: Was ist wichtig? Was nicht? Die Medikamentengabe kann ich nicht wegkürzen, höchstens etwas nach hinten verschieben. Aber Mobilisierungen fallen aus, das heißt, einer Patientin wird nicht geholfen, sich aufzurichten und an die Bettkante zu setzen. Auch für Gespräche, die tiefer gehen als: „Wie geht es Ihnen? Wie fühlen Sie sich?“, habe ich keine Zeit mehr. Dabei ist das besonders auf der Intensivstation wichtig, wo sich die Menschen in einer Ausnahmesituation befinden.
„Gerade so“ reicht mir nicht
Der Zeitdruck führt bei mir zu einem inneren Druck. Ich bekomme ein beklemmendes Gefühl in der Brust, werde reizbar. Kleinigkeiten regen mich auf: wenn ein Mülleimer voll ist, Verbandsmaterial fehlt. Manchmal entlädt sich der Groll und ich schimpfe los.
Vielleicht muss ich kurz an die frische Luft. Oder einen Schluck Kaffee trinken. Manchmal fällt mir selbst nicht mehr auf, dass ich eine Pause brauche – besonders nach langen Notfalleinsätzen. Erst wenn eine Kollegin fragt: „Ist alles in Ordnung?“, merke ich: „Nein, ist es gerade nicht.“
Mein Dienst endet immer mit einer Dienstübergabe. Auf der Intensivstation sind alle Schichten gleichberechtigt. Das heißt, wenn die Frühschicht es nicht schafft, die Schläuche an den Beatmungsgeräten zu wechseln, kann das auch die Folgeschicht tun. Wir machen uns untereinander keine Vorwürfe, wenn Aufgaben nicht erledigt wurden. Es rollt höchstens mal einer mit den Augen.
Aber ich fühle mich schlecht. Ich arbeite doch nicht in diesem Beruf, um das Minimum zu schaffen. Ich möchte ihn sehr gut machen. Ich habe einen hohen Anspruch an mich. Vielleicht manchmal zu hoch. „Gerade so“ reicht mir nicht. Es muss sehr gut sein. Das habe ich in der Ausbildung gelernt, das haben mir meine Eltern vorgelebt und so bin ich auch im Privatleben. Lieber 110 Prozent als 90.
Aber wenn eine Person akut Hilfe braucht oder sehr schwer erkrankt ist, nutze ich fast meine gesamte Arbeitszeit für sie. Gegenüber den anderen ist das ungerecht. Ich kann meine Arbeit nicht so erledigen, wie es erforderlich wäre. Bei meinen Kolleginnen und Kollegen ist es ähnlich. Wir alle möchten die Patienten gut, zielgerichtet und gesundheitsfördernd versorgen. Wenn wir nach acht Stunden feststellen, dass wir zwar pausenlos gearbeitet, aber trotzdem nicht alles geschafft haben, ist das belastend und frustrierend.
Keine Abstriche bei der Versorgung
In der Umkleide denke ich oft über meine Entscheidungen nach: Wenn ich feststelle, dass ich trotz des Zeitdrucks die Prioritäten richtig setzen konnte, löst sich der Druck, der Stress lässt nach. Sonst spreche ich mit einem Kollegen oder mit meiner Partnerin darüber. Wenn uns etwas stärker belastet, können wir uns an eine speziell ausgebildete Ansprechperson auf Station wenden.
Um den Zeitdruck der Arbeit auszugleichen, versuche ich, es im Privaten lockerer angehen zu lassen. Vielleicht komme ich mal fünf Minuten zu spät zu einer Verabredung. Das fällt mir schwer. Aber ich bin dabei, meine Ansprüche an mich selbst herunterzuschrauben. Bei meinem Ehrenamt im Rettungsdienst und Katastrophenschutz ist es den anderen schon aufgefallen, dass ich an einem Tag versuche, alles perfekt zu machen, und am nächsten Tag sage: Passt schon. Es stört sie nicht, eher stößt es auf Zuspruch. Nach dem Motto: „Gut, dass du es verstanden hast.“
Eine Sache habe ich mir allerdings vorgenommen: Bei der Patientenversorgung will ich keine Abstriche machen. Bei allem anderen – Dokumentation, Ordnung – dürfen es auch mal 90 Prozent sein. Da nicht.
Trotz des Zeitdrucks erlebe ich meine Arbeit als sinnstiftend und erfüllend. Deshalb ärgert es mich, wenn Pflegefachpersonen selbst schlecht über den Beruf sprechen und Hospitantinnen auf Station geraten wird: „Mach lieber etwas Vernünftiges.“ Wir müssen unseren Beruf positiv repräsentieren! Und so wie es die Ärztekammern gibt, müsste es auch Pflegekammern geben, die unsere Interessen vertreten. Nur wenn wir selbst über unseren Job und die Rahmenbedingungen entscheiden, können wir die Belastungen langfristig verringern. Da bin ich mir sicher.
Wollen Sie mehr zum Thema erfahren? Dann lesen Sie außerdem das Interview mit Marius Binneböser über die Folgen des Personalmangels in der Pflege in Zeitdruck im Beruf.
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? Wir freuen uns über Ihr Feedback!
Haben Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Beitrag oder möchten Sie uns eine allgemeine Rückmeldung zu unserem Magazin geben? Dann schreiben Sie uns gerne eine Mail (an:redaktion@psychologie-heute.de).
Wir lesen jede Nachricht, bitten aber um Verständnis, dass wir nicht alle Zuschriften beantworten können.