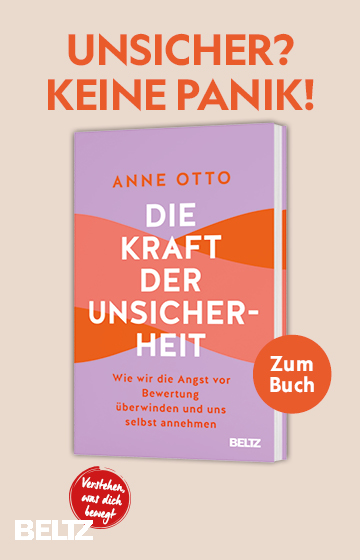Die junge Frau wirkt, als sei sie einem Film entsprungen. Man könnte auf den ersten Blick an die Figur der geradezu penetrant glücklichen und freundlichen Pauline alias Poppy aus Mike Leighs romantischer Komödie Happy-Go-Lucky denken; doch der Eindruck täuscht. Die Aura der Lebenskünstlerin, die Frau G. wie einen schützenden Mantel um sich drapiert, verbirgt eine traurige Realität zahlloser trister Affären, in denen sie die Männer manipuliert, ihnen das Geld aus der Tasche zieht und sie offenbar ohne schlechtes Gewissen wieder verlässt. Ihr einziger Freund scheint ein namenloser zugelaufener Kater zu sein, mit dessen Unabhängigkeit sie sich wohl identifiziert.
Frau G. strahlt eine unbändige Lebenslust aus und zugleich eine abgrundtiefe Melancholie, der sie sich in regelmäßigen Abständen hingibt. Ihr Leben wirkt – um auf den ersten Eindruck zurückzukommen – wie seine eigene Verfilmung, in der ihre traurige Biografie erst nach und nach enthüllt wird. Doch auch diese Enthüllungen haben immer etwas Moviehaftes.
Selbst das offenkundigste Elend hat etwas Glamouröses an sich. In den Gesprächen mit ihr fühlt man sich eher als Mitdarsteller, Zuschauer oder Filmkritiker denn als Therapeut. Man könnte sagen, in ihrer Therapie geht es vor allem darum, sich nicht dem Wunsch nach einem happy ending hinzugeben, sondern – um Freuds berühmten Satz aus den Studien über Hysterie zu zitieren – sich damit zu bescheiden, „hysterisches Elend in gemeines Unglück“ zu verwandeln.
Aus welchem Buch stammt die beschriebene Patientin? Hier finden Sie die Auflösung.
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? Wir freuen uns über Ihr Feedback!
Haben Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Beitrag oder möchten Sie uns eine allgemeine Rückmeldung zu unserem Magazin geben? Dann schreiben Sie uns gerne eine Mail (an: redaktion@psychologie-heute.de).
Wir lesen jede Nachricht, bitten aber um Verständnis, dass wir nicht alle Zuschriften beantworten können.