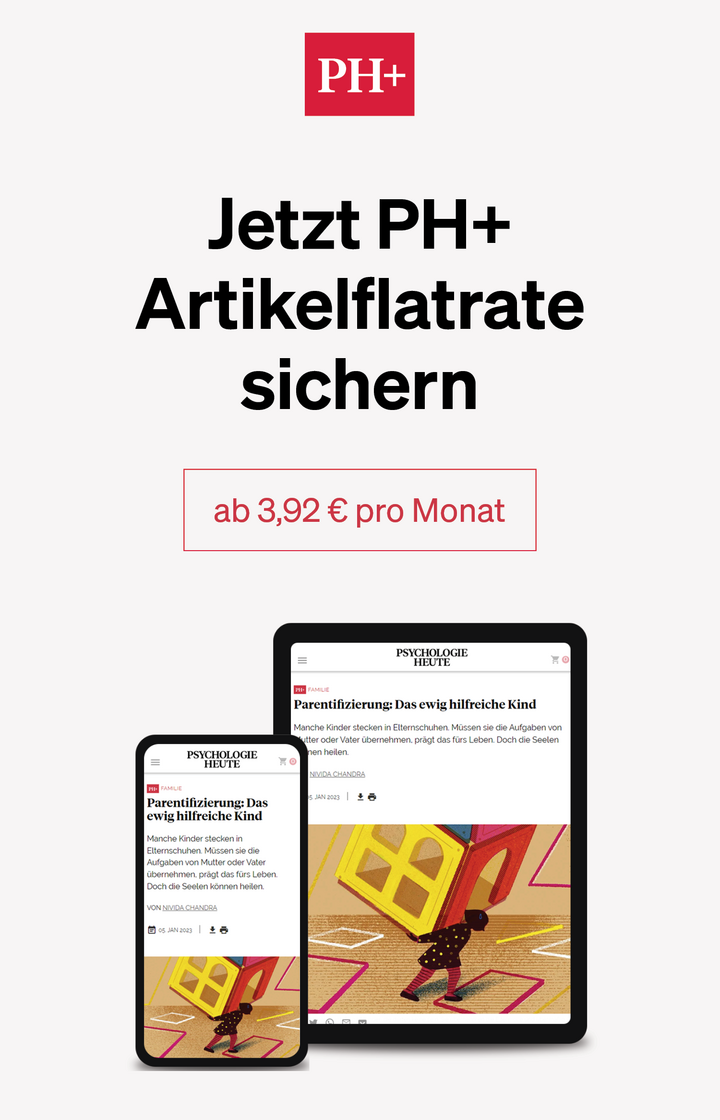Die Traurigkeit, die man empfindet, wenn ein guter Freund das in ihn gesetzte Vertrauen missbraucht hat. Die Wut, die während eines Streits mit dem Partner hervorbricht. Die Angst davor, was die Zukunft bringt: All das sind negative Gefühle, die man eigentlich nicht erleben will. Eigentlich. Denn es gibt durchaus Menschen, die diesen negativen Emotionen etwas Positives abgewinnen können. Wie man eine Emotion erlebt, hängt wohl nicht nur von dem Gefühl selbst ab, sondern auch davon, was für eine Meinung wir darüber haben:
„Nehmen wir an, jemand hält Emotionen für schlecht, gefährlich oder unvernünftig“, illustriert die Psychologin Brett Ford von der University of Toronto das Phänomen. „Wenn dieser Mensch sich dann beispielsweise ärgert, wird er sich mit hoher Wahrscheinlichkeit wünschen, diesen Ärger zu vermeiden. Dazu wird die Person verschiedene Strategien ausprobieren, die sie für geeignet hält. Falls ihr das nicht gelingt, wird sie es in Zukunft noch intensiver versuchen.“
Ist Wut wertvoll?
Zusammen mit James Gross von der Stanford University erforscht Ford Überzeugungen, die Menschen über Emotionen haben. Offenbar ist es nicht selbstverständlich, dass wir unangenehme Gefühle immer schlecht finden und positive immer gut, es kann auch umgekehrt sein. Laut den Forschungsergebnissen, die die beiden Psychologen zitieren, halten Menschen unangenehme Gefühle unter gewissen Umständen für wünschenswert oder angenehme für schädlich.
Solche Bewertungen könnten sich langfristig auf die psychische Gesundheit auswirken. In einer Studie erlebten Menschen, die Wut für wertvoll erachteten, vermehrt Wut und Aggression, während solche, die in der Traurigkeit etwas Wertvolles sahen, mehr depressive Symptome aufwiesen.
Menschen bewerteten aber nicht nur bestimmte Gefühle in einer konkreten Situation als positiv oder negativ, sondern hätten auch eine Meinung dazu, ob diese generell gut oder schlecht seien, so Ford und Gross. Auch das wirke sich gesundheitlich aus. Die Forscher fanden heraus, dass Menschen, die Gefühle ganz allgemein für etwas Negatives hielten, in eher schlechter psychischer Verfassung waren sie gaben ein weniger ausgeprägtes Wohlbefinden an und zeigten mehr Symptome von Angst und Depression als diejenigen, die Emotionen normalerweise gut fanden.
Von Meinungen und Metagefühlen
Die Beurteilung von Gefühlen beschränke sich nicht darauf, ob wir diese gut oder schlecht finden, sagen Ford und Gross. Vielmehr denken manche von uns, Gefühle könne man im Griff haben, andere halten sie generell für schwer kontrollierbar. Wer Letzteres glaubt, erlebt negative Gefühle intensiver, verhält sich aber auch empathischer und mitfühlender gegenüber anderen, die sich gerade schlecht fühlen. Das belegt eine Studie, in der Eltern zu den Gefühlen ihrer Kinder befragt wurden. Wenn die Eltern diese für relativ unkontrollierbar hielten, unterstützten sie ihre Kinder mehr und bestraften sie weniger.
Darüber hinaus ist die Überzeugung, man könne Gefühle nicht kontrollieren, aber wohl eher ungünstig – Studienteilnehmer, die so dachten, zeigten häufiger Anzeichen von Depressionen.
Wie kann es sein, dass unser Denken über Gefühle solche Auswirkungen auf unsere psychische Gesundheit hat? Wie die beiden Psychologen schreiben, ist dabei die Kontrollierbarkeit der entscheidende Punkt. Nur wenn wir glauben, unsere Emotionen steuern zu können, bemühen wir uns offenbar, dies auch zu tun, also sie beispielsweise nicht einfach „herauszulassen“, sondern sie umzudeuten und positiver zu sehen als vorher. Psychologen nennen das Emotionsregulation. Für unsere psychische Gesundheit ist es wichtig, dass wir versuchen, heftige Gefühle zu regulieren, und davon überzeugt sind, dass uns das auch gelingt.
Meta-Emotionen
Diese Theorien zeigen, wie kompliziert die Vorgänge in unserer Psyche sind. Und es wird noch komplexer. Denn solche Gedanken, ob eine Emotion einerseits gut und andererseits kontrollierbar ist, können auch gemeinsam auftreten und sich gegenseitig beeinflussen. Wenn man beispielsweise glaubt, ein Ereignis löse negative und unbeeinflussbare Emotionen aus, steigt das Risiko für Depression. Dann haben wir beunruhigende Gefühle über die aktuellen Gefühle, vermuten Ford und Gross, sogenannte „Meta-Emotionen“.
Noch seien jedoch viele Fragen zu unseren Meinungen und Metagefühlen offen, konstatieren die beiden Psychologen. Sie nehmen an, dass kulturelle Werte eine wichtige Rolle spielen, wenn wir uns Meinungen über Gefühle bilden und uns beispielsweise für unseren schlechten Gefühle selbst kritisieren.
Brett Ford empfiehlt, sich von solchen Bewertungen eigener Emotionen möglichst zu lösen. Man könne versuchen, die eigenen Emotionen neutral und wertfrei zu betrachten. „Wenn Menschen ihren Emotionen und Gedanken gegenüber sehr kritisch eingestellt sind, leiden sie mit einer höheren Wahrscheinlichkeit darunter. Am Ende des Tages sind unangenehme Emotionen und Gedanken unvermeidlich. Statt sie kritisch zu beurteilen, sollten wir ihnen gegenüber offen und neugierig sein.“
Brett Q. Ford, James J. Gross: Why beliefs about emotion matter: An emotion-regulation perspective. Current Directions in Psychological Science, 28/1, 2019. DOI: 10.1177/0963721418806697
Brett Q. Ford u.a.: The psychological health benefits of accepting negative emotions and thoughts: Laboratory, diary, and longitudinal evidence. Journal of Personality and Social Psychology, 115/6, 2018. DOI: 10.1037/pspp0000157
Liat Netzer u.a.: Interpersonal instrumental emotion regulation. Journal of Experimental Social Psychology, 58, 2015. DOI: 10.1016/j.jesp.2015.01.006