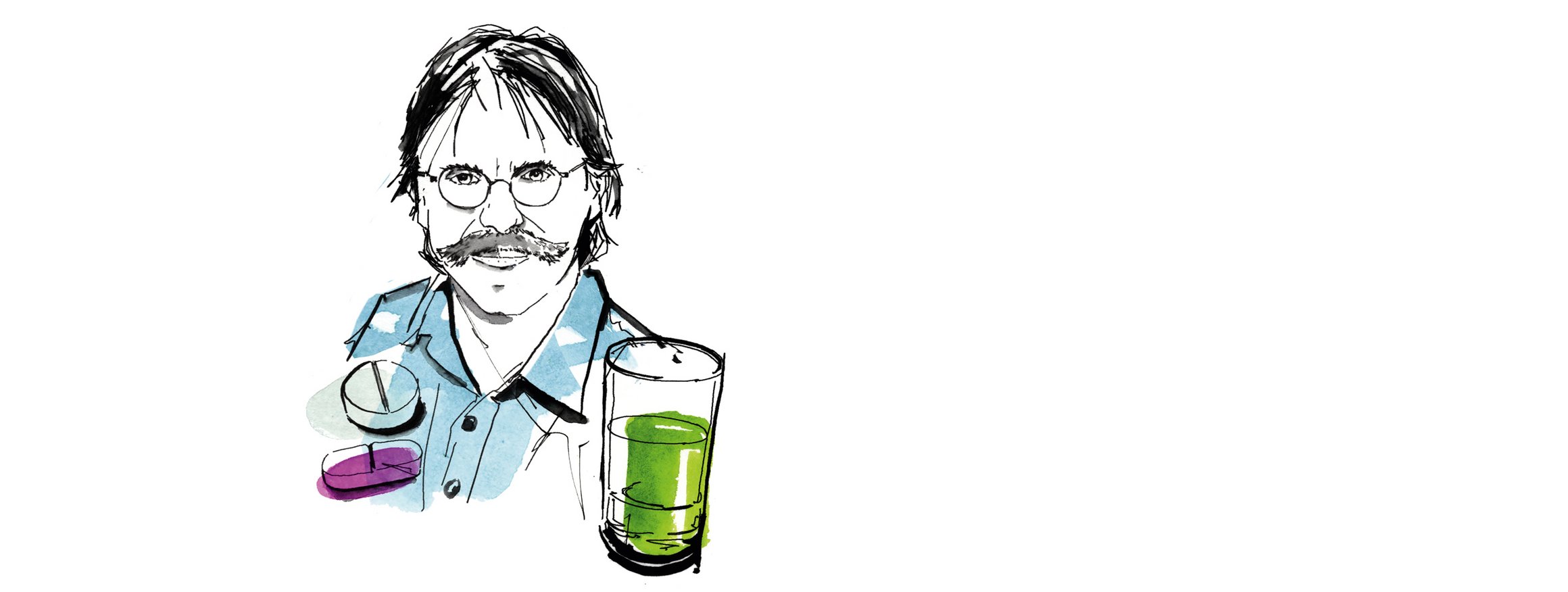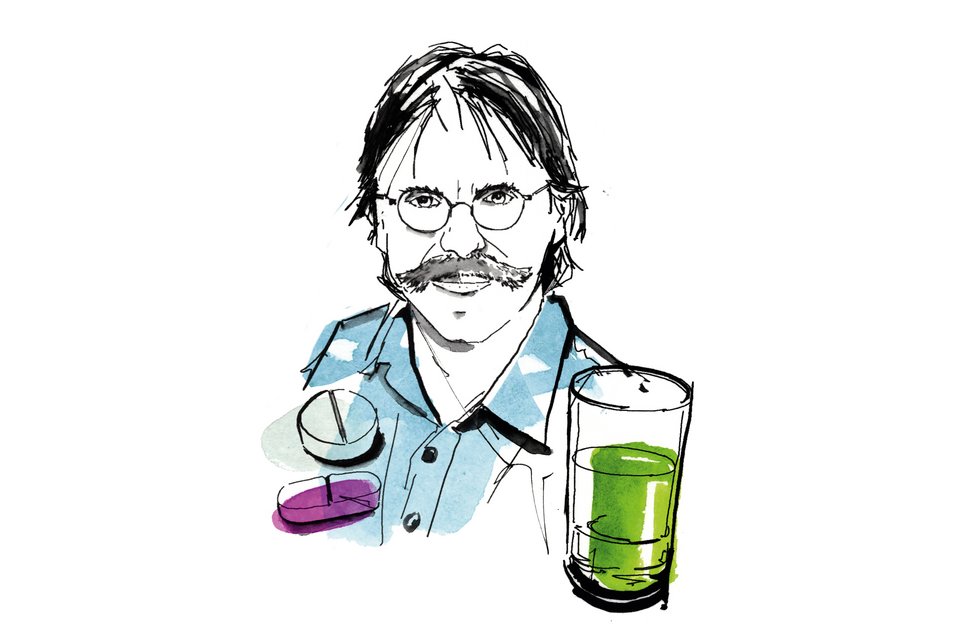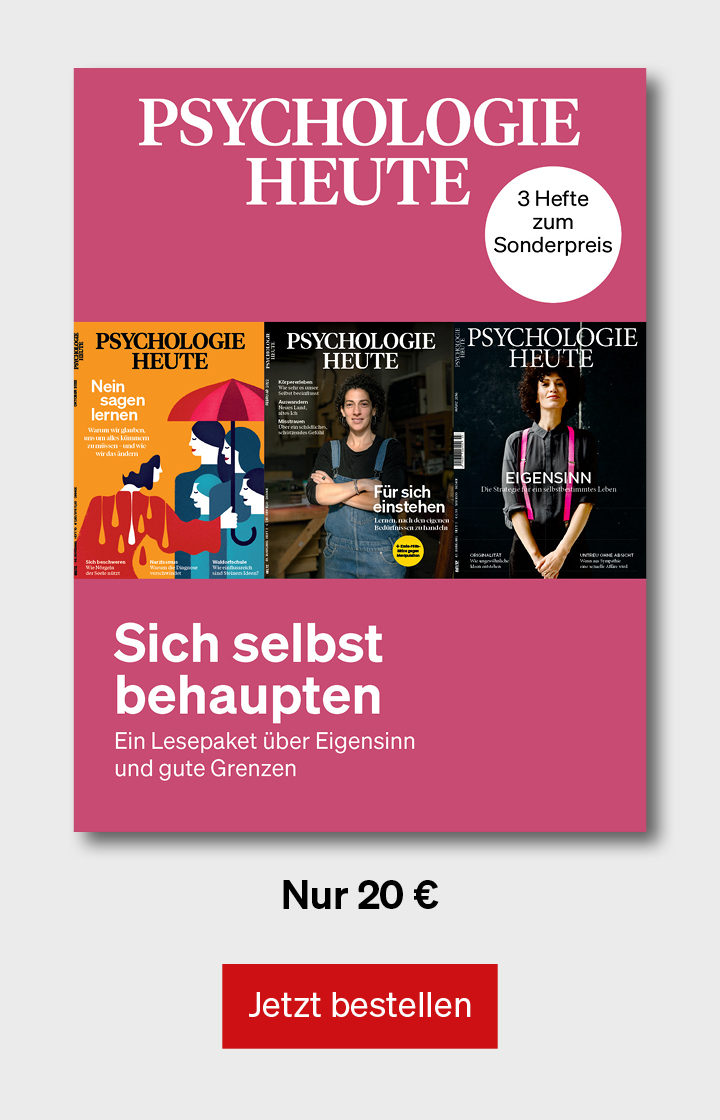Es war ein besonderer Saft, den der Medizinpsychologe Manfred Schedlowski mit seiner Arbeitsgruppe am Universitätsklinikum Essen da zusammenbraute. Der Trank sollte, um jegliche Assoziation fernzuhalten, an keine gängige Geschmacksrichtung erinnern. Nach vielerlei Versuchen mit unterschiedlichsten Ingredienzen lief es auf eine grüne Brühe aus Erdbeermilch mit einem Schuss Lavendel heraus, der man eine gewisse Mottenkugelnote im Abgang nachsagte. 34 junge Männer nahmen den Spezialdrink viermal im Abstand von zwölf Stunden zu sich – immer zusammen mit der Kapsel eines Medikaments, das die Immunabwehr hemmte. Nach fünf Tagen Pause kam der grüne Saft abermals viermal zum Einsatz; diesmal allerdings enthielt die Begleitkapsel keinerlei Wirkstoff, war also ein Placebo.
Wie sich herausstellte, entfaltete nicht nur das Medikament die erwartete immunsuppressive Wirkung, sondern anschließend auch das Placebo. Das war insofern erstaunlich, als die Probanden keinen Schimmer hatten, was sie da schluckten. Sie konnten also keine sich selbst erfüllende Erwartung haben, wie sie für den Placeboeffekt typisch ist. Stattdessen wirkte das Placebo über einen anderen Mechanismus: die „klassische Konditionierung“. Es war wie bei Pawlows Hunden, denen schon beim Glockenton, der immer das Futter ankündigte, der Speichel lief. Die Rolle der Glocke übernahm in Schedlowskis Experiment der grüne Saft. Er signalisierte dem Gehirn: Jetzt solltest du das Immunsystem herunterfahren.
Die Entdeckung lässt auf einen klinischen Einsatz bei Menschen mit einem transplantierten Organ oder einer Autoimmunerkrankung hoffen: Sie könnten dank des Placebos mit weniger immunsuppressiven Medikamenten auskommen. In einer Pilotstudie mit Nierentranspantierten hat Schedlowskis Team schon nachgewiesen, dass dies funktionieren kann.
2018 Schedlowski und Witzke erproben die Placebokonditionierung bei Nierentransplantierten
2002 Manfred Schedlowski narrt die Immunabwehr mit einem Nonsens-Drink.
1975 Ader und Cohen konditionieren bei Ratten eine Immunhemmung
1955 Henry Beecher weist Placebowirksamkeit gegen Schmerzen nach
1905 Iwan Pawlows Hunde sabbern beim Glockenton
1772 William Cullen verordnet ein wirkstoffloses Mittel und nennt es „Placebo“
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? Wir freuen uns über Ihr Feedback!
Haben Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Beitrag oder möchten Sie uns eine allgemeine Rückmeldung zu unserem Magazin geben? Dann schreiben Sie uns gerne eine Mail (an: redaktion@psychologie-heute.de).
Wir lesen jede Nachricht, bitten aber um Verständnis, dass wir nicht alle Zuschriften beantworten können.