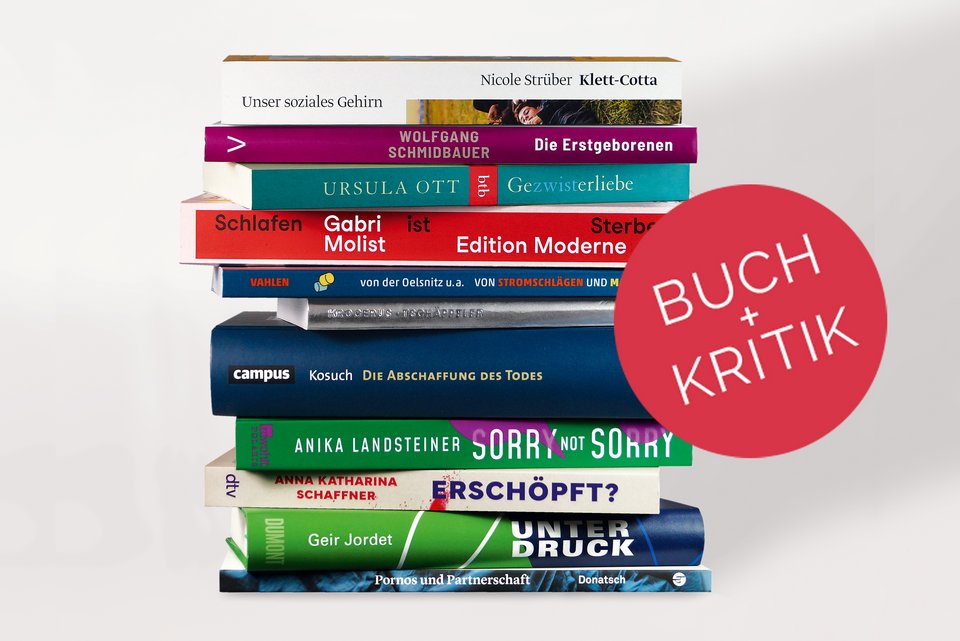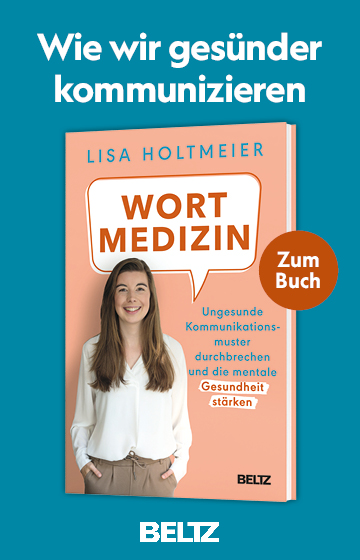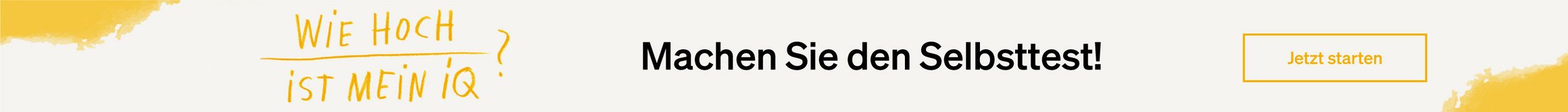Müdigkeit und Erschöpfung scheinen universale Phänomene zu sein. Ob unsere Vorfahren vor einem Jahrtausend oder wir heute: Jeder Mensch erfährt die Energielosigkeit am eigenen Leib. Interessanterweise haben Menschen in jedem Zeitalter dieser Erfahrung unterschiedliche Namen verliehen und ihre Ursachen mit jedem gesellschaftlichen Wandel neu definiert. Heute ist uns eine Form der Erschöpfung als Burnout bekannt.
Vor rund 150 Jahren war es die Neurasthenie, vor 500 Jahren die Melancholie. Die Autorin Anna Katharina Schaffner verwebt Geschichte mit der Gegenwart auf eine Weise, die ihr Buch zu dem Thema Erschöpfung zu einer abwechslungsreichen Lektüre macht.
Selbstwert systematisch untergraben
Schaffner ist Professorin für Kulturgeschichte an der University of Kent und erforschte die historische Bedeutung des Phänomens „Erschöpfung“ – dann erlitt sie selbst einen Burnout. „Nach einem kurzen Flirt mit der Psychoanalyse habe ich schließlich eine Coachingausbildung gemacht, eine eigene Praxis eröffnet und mich darauf spezialisiert, erschöpfte Menschen zu unterstützen“, schreibt sie. Aber ihr Buch ist kein psychologischer Ratgeber, sondern eine Sammlung von 26 kürzeren Essays mit geschichtswissenschaftlichen Einblicken. Der Buchtitel Erschöpft? Belebende Perspektiven fur mude Menschen ist daher ein wenig irreführend.
Alle Essays üben Gesellschaftskritik. Schaffner geht in ihnen beispielsweise auf die heutige Fetischisierung von Arbeit und Leistung ein und diskutiert problematische Folgen wie perfektionistische, gar unrealistische Erwartungen an sich selbst. Dabei greift die Autorin auch den inneren Kritiker auf, diese immerzu unzufriedene Stimme in unserem Ohr. „Wäre unser innerer Kritiker eine reale Person, würden wir sie meiden wie die Pest. Sie fiele in die gleiche Kategorie wie Mobbing- oder Missbrauchstäter: Menschen, die systematisch unser Selbstwertgefühl untergraben“, schreibt Schaffner. Auch thematisiert sie den ungesunden Umgang der Gesellschaft mit Niederlagen. „Die Verunglimpfung von ‚Losern‘ beziehungsweise ‚Versagern‘ ist fest in unserer Kultur verankert.“
Die Autorin erwähnt zwar mögliche Ursachen von heutigen Müdigkeitssyndromen, aber eine tiefere Analyse bleibt aus. Das liegt sicherlich nicht am Wissensmangel, wie ihre früheren Bücher belegen, sondern an dem essayistischen Format ihrer neuen Veröffentlichung.
Eine Art Tod mitten im Leben
Jeder ihrer Essays ist ein Kapitel –alphabetisch geordnet von A wie Akzeptanz über L wie Lebenskosten bis hin zu Z wie Zeitgeist. Man kann also ganz spontan entscheiden, in welcher Folge man die Essays lesen möchte. So begegnet Schaffners Leserschaft in einem der Essays dem Faulpelz Oblomow, dem Protagonisten des gleichnamigen Romans aus dem Jahr 1859. „Indem er sich von aller Arbeit, allem Einsatz, allen Unannehmlichkeiten und Risiken lossagt, betreibt er eine Art Tod mitten im Leben und eliminiert viel von dem, was das Leben überhaupt erst ausmacht“, so Schaffner. Dennoch schlägt sie vor, von Oblomow zu lernen, lässt aber ungesagt, was wir lernen könnten. Es sind vage Ansätze wie Oblomows Verneinung jedweder Leistung, mit denen die Autorin uns hier zum Nachsinnen bringen möchte.
Artikel zum Thema
Zwischendurch erfährt man auch Unterhaltsames aus der Kulturgeschichte der Müdigkeitssyndrome, etwa wie ein Alchemist eine Pille gegen die melancholische Erschöpfung erfand und sie „die Goldene“ nannte. Aber Schaffners historische Expertise kommt nur bedingt zum Zuge, was gerade bei einem universalen Phänomen wie der Erschöpfung schade ist. Ihre Leserinnen und Leser hätten möglicherweise von den Erfahrungen früherer Generationen lernen können.
Zwar sind die Denkimpulse, die Schaffner mit ihren Essays bietet, mitnichten banal. So schreibt die Autorin beispielsweise, dass es sich lohnt zu überlegen, was der Einzelne eigentlich unter Scheitern versteht. Damit lädt sie uns ein, Abstand von problematischen gesellschaftlichen Vorstellungen zu nehmen, wodurch wir langfristig womöglich anders mit unseren Niederlagen umgehen könnten. Aber solche wertvollen Impulse sind eher rar. Es ist ein wenig enttäuschend, dass die Autorin ihre Überlegungen zwar elegant, aber selektiv und unsystematisch präsentiert – und die Lesenden im Grunde die Arbeit machen lässt.
Anna Katharina Schaffner: Erschöpft? Belebende Perspektiven für müde Menschen. Aus dem Englischen von Beate Schäfer. Dtv 2024, 240 S., € 18,–
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? Wir freuen uns über Ihr Feedback!
Haben Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Beitrag oder möchten Sie uns eine allgemeine Rückmeldung zu unserem Magazin geben? Dann schreiben Sie uns gerne eine Mail (an: redaktion@psychologie-heute.de).
Wir lesen jede Nachricht, bitten aber um Verständnis, dass wir nicht alle Zuschriften beantworten können.