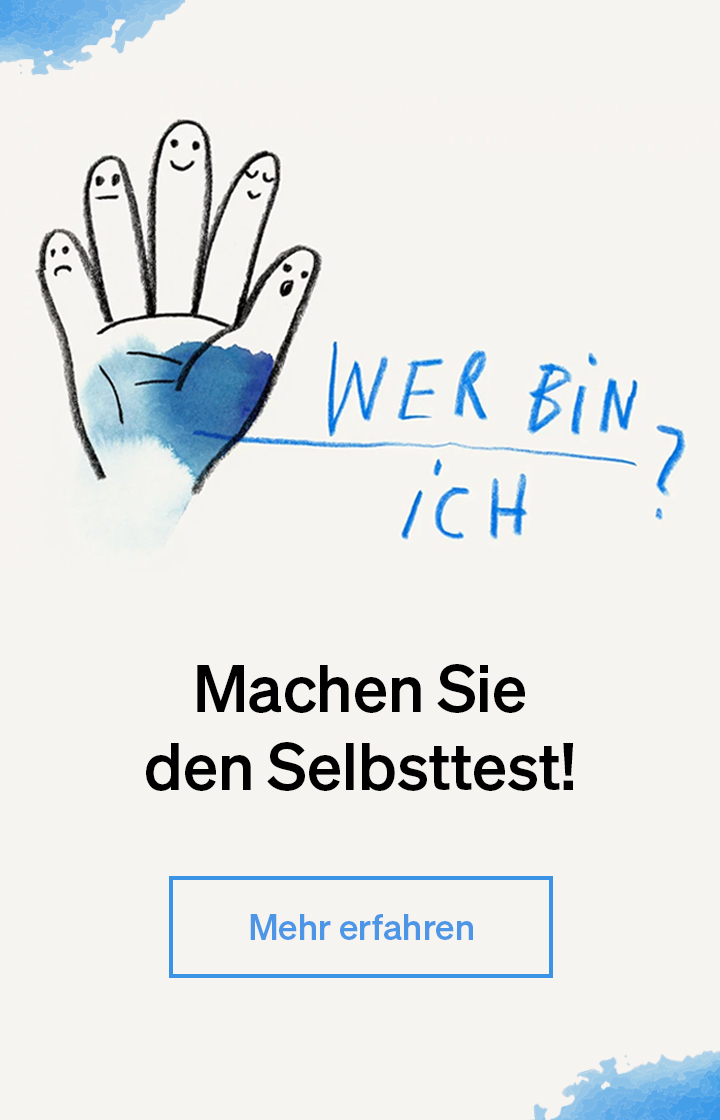Vor einem Jahr beschloss Kelly Mertens, eine fremde, psychisch kranke Frau bei sich aufzunehmen. Damals war sie 39 Jahre alt, wohnte in einem Reihenhaus aus Backstein, versorgte tagsüber im Garten drei Pferde, ein Pony, zwei Schweine, drei Gänse, fünf Hunde und ein Gehege voller Hühner – und arbeitete nachts in einer Kleiderfabrik. Sie hatte viel zu tun, trotzdem verspürte sie das Bedürfnis, sich noch um einen anderen Menschen zu kümmern.
Cindy Yseboodt wuchs in der Nähe auf, und in ihrem Zuhause geschahen Dinge, die ihr die Tränen in die Augen trieben. Sprechen möchte die 45-Jährige darüber nicht, nur so viel: Seit ihrem 17. Lebensjahr war sie immer wieder in psychiatrischer Behandlung. Dank Medikamenten ist sie heute stabil genug, um nicht in einer Klinik leben zu müssen. Doch noch immer kann sie nicht länger als 30 Minuten allein sein.
Die eine Frau suchte einen Menschen, um den sie sich kümmern kann, die andere jemanden, der sich um sie kümmert. Beide sagen heute: Sie sehnten sich nach einer Familie. Also beschlossen sie, eine zu werden.
Diese Reportage ist im März 2025 mit dem Herbert Pichler-Inklusions-Medienpreis prämiert worden. Autor Joshua Kocher und Fotograf Rémy Vroonen erhielten den Preis gleichermaßen. Mehr zur Auszeichnung und die Begründung der Jury können Sie hier nachlesen.
Die Zuversicht, die die Frauen bei diesem Vorhaben eint, liegt in Kelly Mertens’ Wohnort quasi in der Luft. Geel, eine 41000 Einwohner große belgische Stadt in der Nähe von Antwerpen, wirkt durchschnittlich: ein Marktplatz, ein paar Kneipen, Restaurants und Pommesbuden, ein Bahnhof mit zwei Gleisen. Doch eines macht Geel einzigartig: die Fürsorge seiner Einwohnerinnen und Einwohner. Sie nehmen psychisch kranke Menschen bei sich auf und leben oft bis ans Lebensende mit ihnen zusammen. Seit mindestens 700 Jahren tun die Geeler das. Zeitweise waren fast 4000 Patienten und Patientinnen in den Häusern der Stadt untergebracht. Heute sind es noch etwas mehr als 100.
Von der UNESCO ausgezeichnet
Die Pflegefamilien teilen sich mehr als nur die Wohnung mit jemandem, der an Schizophrenie, einer Entwicklungsstörung oder einer chronischen Depression leidet, sie teilen Alltag, Leiden, Leben. Von psychiatrischer Familienpflege spricht man in diesem Zusammenhang, eine Art betreutes Wohnen für Menschen mit einer „psychologischen Vulnerabilität“, wie es in einer Selbstbeschreibung des Projekts heißt. Bereits 1902 wurde das Modell, wie es in Geel gelebt wird, vom Internationalen Psychiatriekongress als nachahmenswert eingestuft.
Ende vergangenen Jahres erkor es die UNESCO zum immateriellen Kulturerbe. Weltweit wurde dem Konzept nachgeeifert, in Japan, Frankreich und auch in Deutschland. Doch nirgends war es so erfolgreich wie hier, wo man seit Jahrhunderten vorlebt, wie gut einem psychisch kranken Menschen der Alltag in einer Familie tun kann, zu der er wie selbstverständlich gehört.
„Wir fühlen uns wie Schwestern“
Ende Januar 2024 öffnet Kelly Mertens die Tür ihres Backsteinhauses, hinter ihr im Wohnzimmer kläffen fünf Chihuahuas. Das Reporterteam wird von dem betreuenden Psychologen und einer Krankenschwester begleitet, die das Gespräch aus dem Flämischen ins Englische übersetzen. Am Esstisch richtet Mertens’ Mutter Frieda van Heyst Waffeln und Cola, auf dem Sofa sitzt Cindy Yseboodt und streichelt einen der Hunde. Sie lächelt etwas unsicher, grüßt dann und stellt sofort das Hündchen vor: „Das ist Lucy, ist sie nicht süß?“
Als Kelly, Frieda und Cindy sich zum ersten Mal trafen, im Frühjahr 2023, habe Cindy sich sofort auf die braune Lucy gestürzt, erinnert sich Kelly. „Es war klar, das ist jetzt ihr Hund.“ Zum Geburtstag schenkte sie ihr später eine Brotdose und einen Geldbeutel, bedruckt mit einem Foto des Lieblings.
Fast ein ganzes Jahr wohnen die drei Frauen nun zusammen, und es wirkt, als wäre es schon viel länger. Sie kleiden sich ähnlich, sie scherzen viel, sie foppen sich, und immer wieder geht es um die Hunde. „Es passt perfekt bei uns“, sagt Kelly und lächelt Cindy an. „Wir fühlen uns wie Schwestern“, entgegnet diese. Kellys Mutter Frieda wird von Cindy Moeke, Mutti genannt.


Damon, Dymphna und Gerebernus
Die besondere Rolle, die ihr Wohnort bei all dem spielt, geht auf eine grausame Geschichte zurück. 600 Jahre nach Christi flüchtete die junge Dymphna über den Ärmelkanal. Ihr Vater Damon, König eines kleinen Reiches in Irland, wollte sie heiraten, weil sie ihrer jüngst verstorbenen Mutter so ähnelte. Doch Dymphna lehnte als Christin ab und floh mit dem Priester Gerebernus in ein Waldstück bei Geel. Dort spürten ihr Vater und seine Wachen sie auf, töteten den Priester, und Damon bat Dymphna erneut um ihre Hand. Als sie erneut ablehnte, nahm er sein Schwert – und schlug ihr den Kopf ab.
In der Sage heißt es, die Geeler hätten beschlossen, Dymphna und Gerebernus ein würdevolles Begräbnis zu ermöglichen, schließlich sei Dymphna als Märtyrerin gestorben. Also legten sie beide in einen steinernen Sarkophag und bauten eine Kapelle, wo sie bis heute aufgebahrt liegen sollen. Vor ein paar Jahren öffneten Forschende den Sarg und fanden darin drei Oberschenkel- und einen Kieferknochen, die eine Radiokarbonanalyse auf das siebte und das neunte Jahrhundert datierte. Außerdem war noch ein Medaillon aus Ton dabei, auf dem „Dymphna“ geschrieben stand.
Heilende Gebeine
Ob wahr oder nicht: Aus der Kapelle wurde rasch ein Wallfahrtsort und aus Dymphna Sankt Dymphna, Schutzheilige der psychisch Kranken. Aus ganz Europa pilgerten spätestens ab Mitte des 14. Jahrhunderts Menschen nach Geel. Später übernachteten Kranke neun Tage lang in einem Zimmer, das an die inzwischen entstandene Kirche angebaut worden war, und krochen dreimal täglich unter den Gebeinen der Heiligen hindurch. Danach galten sie als geheilt.
Der Ansturm sei irgendwann so groß geworden, erzählt eine Mitarbeiterin der Kirchengemeinde, dass die Pilger lange warten mussten, ehe Platz im Krankenzimmer war. Da begannen die Anwohner, die Fremden bei sich aufzunehmen und ihnen Arbeit zu geben. Teilweise blieben die Pilger und Pilgerinnen Monate und Jahre, manche kehrten nie wieder nach Hause zurück. Dies war die Geburt der Geeler Familienpflege.
Auch Kelly Mertens’ Großeltern beherbergten einen „Gast“, so nennen die Geeler ihre Mitbewohnerinnen. Oft hatte Mertens daran gedacht, es ihnen gleichzutun, sie hat schließlich keine Kinder und keinen Partner. Doch ihre Nachtschichten ließen das nicht zu. Eines Tages saß sie mit ihrer Mutter Frieda an einem See, erinnert sie sich. Diese plante damals, in Rente zu gehen. Gemeinsam beobachteten sie eine Familie, die von zwei Gästen begleitet wurde. Als Kelly Mertens ihnen zusah, dachte sie: „Vielleicht geht es ja doch.“ Sie sprach mit ihrer Mutter, die anbot, im Ruhestand bei ihr einzuziehen. Sie fragte ihre Großeltern nach deren Erfahrungen – und dann rief sie Wilfried Bogaerts an.
Das Ein und Aus in der Psychiatrie durchbrechen
Der Psychologe organisiert seit fast 30 Jahren die Familienpflege in Geel, die heute am Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZ) angesiedelt ist, der örtlichen Psychiatrie. Längst ist das Projekt seiner kirchlichen Grundlage entwachsen. 1851 hatte das belgische Justizministerium aus Geel eine staatliche psychiatrische Kolonie gemacht, ein Krankenhaus ohne Wände, und baute parallel die medizinische Unterstützung aus. Eine Klinik wurde errichtet, medizinisches und Pflegepersonal eingestellt, langsam hielt die Wissenschaft Einzug. Seit einer Gesetzesänderung von 1991 gilt die Geeler Familienpflege als offizielle psychiatrische Abteilung des OPZ.
Bogaerts, ein hagerer Mann mit hoher Stirn, wählt seine Worte mit Bedacht, auf Anekdoten oder emotionale Lobeshymnen wartet man bei ihm vergeblich. Stattdessen spricht er immer wieder von Stabilität. Das sei das höchste Ziel seines Teams aus fünf Krankenpflegerinnen und Krankenpflegern, einer Sozialarbeiterin sowie drei Psychiaterinnen und Psychiatern, die sich um die Familien kümmern. „Viele der Patienten und Patientinnen gehen über Jahre ein und aus in der Psychiatrie. Wenn es gelingt, das zu durchbrechen, ist es schon ein Erfolg“, sagt er nüchtern.
Wilfried Bogaerts ist unter anderem beim Matching involviert, er bringt mit seinem Team Gast und Familie zusammen. Meistens laufe es so wie bei Kelly Mertens, sagt er. Fast alle Interessenten hätten eine Verbindung zu einer Pflegefamilie, kennen das System etwa von Verwandten. Wenn es in die Lebensplanung passt, meldeten sie sich. Früher seien das oft Menschen gewesen, die gerade Kinder bekamen. Heute sind die Pflegeeltern meist älter, reduzierten gerade die Arbeitszeit und liebäugelten mit der Rente oder seien verwitwet und suchten Gesellschaft.
Zuletzt kamen im Schnitt pro Jahr drei Familien hinzu. Gleichzeitig verlassen immer mehr Ältere das System, weil jemand stirbt oder schwer erkrankt. 117 Gäste sind aktuell in Geel und Umgebung untergebracht, etwas mehr Männer als Frauen. Im Schnitt sind sie 66 Jahre alt. Das Durchschnittsalter der 100 Familien, die bis zu drei Gäste aufnehmen dürfen, liegt sogar noch ein wenig höher. Dass sich dennoch immer wieder Menschen wie Kelly Mertens melden, gibt Bogaerts Hoffnung, dass es weitergeht.
Stabilität ist das höchste Ziel
Der Ablauf ist immer ähnlich. Nach einem ersten Telefonat beginnt das OPZ-Team mit dem Screening und besucht die Familie, um sich ein klares Bild von dem Familienleben zu machen und zu entscheiden, ob sie die Betreuung stemmen kann. Das Team sieht sich das Haus oder die Wohnung an, prüft die Größe des Schlafzimmers und fordert ein Attest des Hausarztes an, um sicherzugehen, dass keine ansteckenden Krankheiten vorliegen oder hindernde psychische oder geistige Beeinträchtigungen. Familien mit Vorstrafen sind ausgeschlossen.
Auch der Job beziehungsweise die für die Betreuung verfügbare Zeit muss stimmen. Ein Barkeeper etwa, der jeden Abend Cocktails mixt, hätte es schwer. Kelly Mertens hatte bereits entschieden, nur noch am Wochenende zu arbeiten, und ihre Mutter Frieda, bei Kelly einzuziehen. So konnten sie sich zu zweit um die neue Mitbewohnerin kümmern. Das passte.
Grundsätzlich sei jede Familie für das Programm geeignet, sagt Wilfried Bogaerts. „Wir wollen keine perfekte Familie, wir wollen nur, dass sie sich so normal wie möglich verhält.“ Weder seien überdurchschnittlich viele Familien mit sozialen Berufen im Programm, noch seien es ausschließlich wohlhabende und gebildete. Es sei ein Querschnitt der Bevölkerung.
Im weiteren Verlauf ihrer Bewerbung erzählte Kelly Mertens Wilfried Bogaerts dann, wie sie sich das Zusammenleben mit ihrem Gast vorstellte. Sie sagte, wenn möglich wünsche sie sich eine etwas jüngere Frau, die ein bisschen unabhängig ist. Und natürlich jemanden, der wie sie Tiere liebt.
Cindy Yseboodt durfte 2007 bei ihrer ersten Geeler Pflegefamilie einziehen. Zu ihren echten Eltern hat sie keinen Kontakt mehr. Doch die Pflegemutter verstarb und mit der zweiten verstand sie sich nicht gut. Kelly Mertens und Frieda van Heyst sind ihre dritte Pflegefamilie.
Die Diagnose bleibt Privatsache
Bei der Vermittlung spielt die Erkrankung zunächst keine Rolle. Ein Drittel der Gäste leide an einer Schizophrenie oder an psychotischen Episoden, sagt Bogaerts. Ein weiteres Drittel weist eine Kombination aus geistiger Behinderung und psychischer Störung auf. Der Rest hat emotionale Störungen wie eine Depression oder Persönlichkeitsstörungen. „Das Programm ist für fast alle psychischen Erkrankungen offen“, so Bogaerts. Problematisch seien nur akuter Drogenmissbrauch oder sexuelle Störungen, die eine Gefahr für die Familien oder ihr Umfeld darstellen könnten. „Schwierig wird es auch, wenn jemand jede Nacht aufsteht und die Familie stört“, sagt er. Die Gäste müssen emotional ansprechbar sein, kommunizieren und Dinge selbständig erledigen können, und die Pflege, die sie benötigen, sollte in einem familiären Umfeld beherrschbar sein.
Nach ihren Gesprächen mit Cindy Yseboodt und Kelly Mertens dachten Bogaerts und sein Team: Das könnte funktionieren. Also besuchten sie Mertens und ihre Mutter noch einmal zu Hause und sprachen mit ihnen über Cindy, ihre Hobbys, ihren Charakter und übersetzten ihr der medizinischen Diagnose geschuldetes Verhalten in konkrete Beschreibungen. Die genaue Diagnose verschwiegen sie jedoch. Das ist eines der wenigen eisernen Gesetze des Programms. „Nicht weil wir es den Familien vorenthalten wollen“, sagt Bogaerts, „sondern weil es die Privatangelegenheit der Patientinnen und Patienten ist. Wenn sie es erzählen wollen, sollen sie es erzählen. Wenn sie mit ihrer Vergangenheit abschließen wollen, ist das auch in Ordnung.“
Auf psychische Ausnahmesituationen werden die Familien vorbereitet, eine spezielle Schulung erhalten sie jedoch nicht. „Die Pflegefamilien sollen nicht zu Therapeuten werden“, sagt Wilfried Bogaerts. „Sie sollen ihren Gästen einfach ein möglichst normales Familienleben ermöglichen – was nicht heißt, dass das keine therapeutische Wirkung hat.“ In Notfällen ist das Team des OPZ rund um die Uhr erreichbar, und bei Streitigkeiten bietet Bogaerts ein Gespräch an.
Die volle Existenz unter Gesunden bewahren
In Geel glaubt man, dass manchen Menschen mit chronischen psychischen Erkrankungen das Zusammenleben in der Familie mehr hilft als die dauerhafte Unterbringung in der Psychiatrie oder einer Wohngruppe mit anderen Betroffenen. Wissenschaftlich belegen lasse sich das nicht, sagt Bogaerts. „Aber wir können es an ihrem Verhalten, an der Stabilität und an der Medikation beobachten – die meisten Gäste sind mit ihrer Situation zufrieden.“
Eine der wenigen annähernd messbaren Komponenten sei der Grad der Integration in die Gesellschaft, der an anderen Orten mit ähnlichen Modellen bereits untersucht worden ist, wenn auch selten. In den 1970er Jahren zeigte etwa eine US-amerikanische Forscherin, dass Patienten in den USA ihre sozialen Fertigkeiten nach einem Aufenthalt von vier Monaten in Gastfamilien deutlich verbessert hatten gegenüber einer Kontrollgruppe, die im Wohnheim lebte.
Es sei der inklusive Charakter, die Heranführung an die Gesellschaft, welche die Geeler Familienpflege ausmache, war sich Wilhelm Griesinger sicher, einer der Begründer der modernen Psychiatrie. Er sagte nach einem Besuch in Geel Mitte des 19. Jahrhunderts: „Die familiäre Kranksinnigenpflege gewährt den Kranken das, was die prachtvollste und bestgeleitete Anstalt der Welt niemals gewähren kann, die volle Existenz unter Gesunden, die Rückkehr aus einem künstlichen und monotonen in ein natürliches, soziales Medium, die Wohltat des Familienlebens.“
Griesinger stellte sich damit gegen einen großen Teil seiner Kollegen. Die „Geel-Frage“ wurde erbittert diskutiert, als zwischen 1840 und 1870 das Konzept dieser Familienpflege Einzug in die Wissenschaftsszene fand. Doch bald darauf wurde es europaweit zu kopieren versucht – auch aus praktischen Gründen. In Deutschland etwa waren die Heil- und Pflegeanstalten um die Wende zum 20. Jahrhundert so überfüllt, dass fast alle begannen, ihre Patientinnen in Familien in der Nähe unterzubringen. Während der Weimarer Republik waren im gesamten Deutschen Reich zeitweise etwas mehr als 5000 Patienten so untergebracht, ehe die mörderischen „Euthanasie“-Programme der Nationalsozialisten dem ein grausames Ende setzten.
„Ich wäre am liebsten direkt eingezogen“
Geel erlebte kurz vor dem Zweiten Weltkrieg seinen vorläufigen Höhepunkt. Damals wohnten in der Stadt mit etwa 20000 Einwohnern ungefähr 3700 Gäste in Pflegefamilien: aus den Niederlanden, Frankreich, England, sogar Spanien und Russland. Spätestens da ist wohl das berühmte Sprichwort entstanden: „Halb Geel ist ganz verrückt und ganz Geel ist halb verrückt.“
Kelly Mertens und ihre Mutter Frieda luden Cindy Yseboodt im März 2023 zu einem ersten Kennenlernen ein. Begleitet wurde sie von einer Krankenschwester und einem Psychologen. Sie besprachen praktische Dinge: Wer steht wann auf? Wie könnten die Tage aussehen, wie die Abende? Cindy Yseboodt äußert drei Wünsche: Erstens will sie das Wochenende im Haus verbringen. Zweitens möchte sie Frieda gerne Moeke, Mutti nennen. Und drittens will sie Cola trinken. Das ging in Ordnung. „Ich wäre am liebsten direkt eingezogen“, sagt Cindy Yseboodt heute.
Erfahrungswissen, über Generationen hinweg
Früher waren es oft Bauern, die Gäste bei sich aufnahmen und auf dem Acker und im Stall arbeiten ließen. Die Unterbringung war einfach und auch die Hygiene galt teils als unterdurchschnittlich. Heute werden Familien mit deutlich höheren Standards ausgewählt und bekommen einmal im Monat Besuch von einer Krankenschwester, die nach dem Rechten schaut und die nötigen Medikamente bringt. Doch nach wie vor ist das Modell kaum bürokratisiert: Es gibt keine Kontrollen, keine Berichte – die Familien sollen, so weit es geht, einfach ihr Ding machen.
Im April 2023, vier Wochen nach dem ersten Treffen, zieht Cindy Yseboodt bei Mertens und deren Mutter ein. „Ich war etwas gestresst, weil ich einen guten Eindruck hinterlassen wollte“, erinnert sie sich. Sie bezog ein Zimmer im oberen Stock mit einem großen Bett. „In meiner ersten Nacht schlief ich unglaublich gut.“
In den folgenden Monaten wird sie allmählich Teil der Familie. Sie begleitet Kelly und Frieda zu Geburtstagen, Hochzeiten und Grillabenden, einmal waren sie bei Kellys Schwester im Jacuzzi. Sie nähen zusammen, erzählen sie, Cindy malt am Esstisch Mandalas und Bilder, und am Wochenende, wenn Kelly in die Fabrik geht, füttert Cindy die Tiere.
Der belgische Anthropologe Eugeen Roosens beobachtete das System in Geel über Jahrzehnte. Er schrieb, es scheine in der Geeler Bevölkerung eine Art Erfahrungswissen im Umgang mit psychisch Kranken zu geben, das von Generation zu Generation weitergegeben werde. Die Integration sei nicht gekünstelt, sie sei „natürlich und spontan“.
Immer eine Sache des Geldes
Cindy Yseboodt gilt weiterhin als eingewiesene Patientin des OPZ. Deshalb absolviert sie, wie die meisten Gäste, ein auf sie abgestimmtes Tagesprogramm. Unter der Woche steht sie um 6.30 Uhr auf, verlässt um 8 Uhr das Haus und fährt mit dem Bus ins OPZ. Dort kocht sie mit anderen Patientinnen und Patienten, bastelt Karten, geht kegeln oder ins Kino. Dienstags besuchen sie den Markt. Einige Gäste arbeiten auch ehrenamtlich in Geschäften oder Firmen. Das Tagesprogramm ist einer der Versuche des OPZ, die Geeler Familienpflege an die modernen Lebensrealitäten heranzuführen.
Früher, auf den Bauernhöfen, war immer jemand zu Hause, heute arbeiten die Pflegeeltern oft. Auch die Bezahlung ist ein Thema. Die Familien werden entschädigt, allerdings wurde der Satz seit 1991 nicht mehr erhöht. Er liegt je nach gesundheitlichem Zustand des Gastes zwischen 23,50 und 28 Euro pro Tag.
Die pensionierte Polizistin Greet Vandeperre, die eine Art Aufsichtsrat der Geeler Familienpflege leitet, sagt, das Thema sei ein Dauerbrenner. Bei jedem Treffen des Rates sprächen sie darüber, wie es gelingen kann, mehr Familien für das Projekt zu gewinnen. Am Ende landeten sie immer beim Geld. „Wenn man das System erhalten möchte, müssen die Familien besser bezahlt werden“, sagt Vandeperre. Die Gäste bräuchten abseits der Betreuungszeiten in der Psychiatrie eine Vollzeitunterstützung. Das könne eine gewöhnliche Familie kaum leisten. „Es muss finanziell möglich sein, die Arbeitszeit zu reduzieren“, sagt Vandeperre. Gerade verhandelt das OPZ mit der flämischen Regierung, ob der Satz erhöht wird.
Ein neues Gefühl von Sicherheit
Wenn Cindy Yseboodt gegen 16 Uhr nach Hause kommt, kocht Frieda van Heyst für alle und sie essen gemeinsam zu Abend. Anschließend, so erzählen die drei, setzt sich Yseboodt gerne ihre Kopfhörer auf und hört Musik, melancholische Stücke wie The Sound of Silence von Disturbed, manchmal tanzt sie aber auch euphorisch zu Liedern der belgischen Volkssängerin Liliane Saint-Pierre. Später sitzen die Frauen gemeinsam am Küchentisch und sprechen über ihren Tag, im Hintergrund läuft der Fernseher. Zwischen 20 und 21 Uhr geht Cindy schlafen.
Panische Angst bereitet ihr das Alleinsein, weswegen immer jemand zu Hause sein muss, besonders abends, wenn es dunkel ist. Auch die Nebenwirkungen ihrer Medikamente sorgen für Diskussionen. Ständig schläft Cindy im Sitzen ein, ihr Kinn kippt auf die Brust, was ihr zunehmend Rückenschmerzen bereitet. „Wir sagen ihr ständig, sie soll sich lieber hinlegen“, sagt Kelly Mertens. Doch Cindy vergesse es jedes Mal.
Nach gut einem Jahr des Zusammenlebens sagt Yseboodt: „Früher, wenn ich als Kind von der Schule heimkam, war ich unsicher und nervös, was mich zu Hause erwartet. Das ist jetzt nicht mehr so. Ich fühle mich sicher in meiner neuen Familie.“ Auch wegen Erfahrungen wie dieser: Als sich Frieda kürzlich den Arm brach und im Alltag stark eingeschränkt war, half Cindy Yseboodt ihr, wusch ihr sogar sachte den Arm. Wenn ihre „Mutti“ irgendwann gebrechlich wird, will sie sich jeden Tag um sie kümmern. Sie wollen gemeinsam alt werden.
Wollen Sie mehr zum Thema erfahren? Dann lesen Sie gerne auch das Interview mit Psychologe Michael Konrad über die Umsetzung des Geeler Modells hierzulande in „Gerade herrscht Stillstand“.
Quellen
Egon Erwin Kisch: Belgisches Stadtchen mit 3000 Irren. In: Egon Erwin Kisch: Der rasende Reporter. Klassische Reportagen. Bertelsmann 1963, S. 133–152
Michael Konrad, Jo Becker, Reinhold Eisenhut (Hg.): Inklusion leben. Betreutes Wohnen in Familien für Menschen mit Behinderung. Lambertus 2012
Eugeen Roosens, Lieve Van de Walle: Geel Revisited. After centuries of mental rehabilitation. Garant 2007