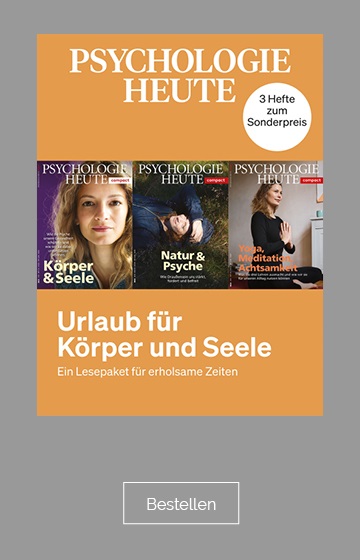In unserer Rubrik Ist das was für mich? stellen wir jeden Monat ein Angebot aus den Bereichen Therapie, Coaching oder Beratung vor. Und Sie können entscheiden, ob das etwas für Sie ist. Dieses Mal: Psychologische Beratung für Studierende.
Das sagt die Ratsuchende
Im zweiten Semester meines Bachelorstudiums hat mich der Klausurenstress überwältigt. Ich war überfordert, nervös, konnte kaum noch schlafen. Mir ging es wirklich schlecht, aber ich habe die Zähne zusammengebissen und das irgendwie durchgestanden. Danach wollte ich nicht, dass sich das bei der nächsten Klausurenphase wiederholt.
Ich brauchte jemanden, der mir helfen könnte, mit dem Stress umzugehen. Zuerst habe ich darüber nachgedacht, eine Therapie anzufangen. Aber irgendwie schien mir das für mein Problem zu viel: mindestens zwölf Sitzungen, eine Diagnose, Anträge bei der Krankenkasse und so weiter. Damit gehen auch eine Menge Verpflichtungen einher. Außerdem waren die Wartezeiten extrem lang. Es hätte wahrscheinlich mindestens ein halbes Jahr gedauert, bis ich einen Platz bekommen hätte. Die nächste Klausur stand aber schon in zwei Monaten an.
Ich habe also nach Alternativen recherchiert und bin auf die psychosoziale Beratung an der Uni gestoßen. Im Gegensatz zur Therapie war das ein ziemlich niedrigschwelliges Angebot. Ich habe eine Mail geschrieben und dann ging alles ganz schnell. Innerhalb von zwei Wochen hatte ich den ersten Termin. Der lief ähnlich ab, wie ich mir ein therapeutisches Gespräch vorstelle. Die Beraterin, Frau Arendt, war allerdings auch Psychotherapeutin, ich habe später erfahren, dass das nicht immer so ist. Ich erzählte ihr von meinen Problemen während der letzten Klausurenphase. Sie hörte mir aufmerksam zu, ging auf mich ein. Ich habe mich wahrgenommen und geschätzt gefühlt. Und es tat gut, einfach mal mit jemandem reden zu können, der einen überhaupt nicht kennt, aber trotzdem zuhört und für einen da ist.
Schon gewusst? Wenn Sie als Studentin oder Student an einer Universität oder Hochschule eingeschrieben sind, erhalten Sie das Psychologie Heute Abo zum Vorteilspreis für Studierende.
Frau Arendt legte mir bei unserem ersten Gespräch nahe, an einem Kurs für mindfulness-based stress reduction (MBSR) teilzunehmen, den sie zu der Zeit selbst an der Uni anbot – ein Achtsamkeitstraining. Der Kurs kam genau zur richtigen Zeit, ein paar Wochen vor der nächsten Klausurenphase. So konnte ich bereits einige Techniken lernen, bevor es wieder richtig losging. Diese Akuthilfe war für mich ein Segen. Die Erfahrungen aus meiner letzten Klausurenphase haben sich danach nie mehr wiederholt.
Nachdem ich so gute Erfahrungen gemacht hatte, habe ich öfter Kontakt mit Frau Arendt aufgenommen, im Schnitt wahrscheinlich einmal jedes halbe Jahr. Meist zu konkreten Anlässen, einmal zum Beispiel wegen einer Trennung, ein andermal wegen eines Streits. Unsere Treffen sahen ganz unterschiedlich aus. Mal haben wir uns nur unterhalten, mal haben wir therapeutische Übungen gemacht. Einmal haben wir ein „inneres Team“ aufgestellt, uns also mit den verschiedenen Anteilen meiner Persönlichkeit, den „Stimmen“ in mir beschäftigt, das war sehr aufschlussreich. Aber am wichtigsten war für mich, dass ich wusste: Da ist jemand und ich kann mit dieser Person über meine Probleme reden, ganz ungezwungen und unverbindlich. Es tat gut, zu wissen, dass das möglich ist.
Meinen Bachelor habe ich abgeschlossen und bin für den Master in eine neue Stadt gezogen. Hier bin ich noch nicht richtig angekommen. Meine erste Anlaufstelle war wieder die psychologische Beratungsstelle an der Uni. Ich musste schnell feststellen, dass der Ansatz hier ein anderer ist, weniger gefühls-, eher handlungsorientiert. Ob mir das gefällt, kann ich noch nicht sagen. Aber ich finde es spannend zu sehen, dass die Angebote doch so unterschiedlich sind. Und wie gesagt: Am Ende ist mir am wichtigsten, nicht allein mit meinen Problemen zu sein, wenn ich mal nicht weiterweiß.
Die Ratsuchende möchte anonym bleiben.
Das sagt die Beraterin
Zur psychosozialen Beratung kommen Studierende meistens mit Problemen, die typisch für diesen Lebensabschnitt sind: Abnabelung vom Elternhaus, Zukunftsfragen, Beziehungsprobleme, Klausurenstress, Schwierigkeiten, Anschluss zu finden. Für viele ist das Studium eine tolle Zeit, man fühlt sich frei, geht viel feiern, lernt Menschen kennen. Aber einige gehen in der Anonymität an der Universität unter. Sie fühlen sich mit der Freiheit überfordert und mit dem Stress allein gelassen. Unter anderem für sie ist die Beratungsstelle da.
Bei uns bekommt man in der Regel innerhalb von zwei bis drei Wochen einen Termin. Zudem gibt es an zwei Tagen pro Woche eine offene Sprechstunde. Wer dort vorbeikommt, nimmt zwar das Risiko in Kauf, dass die Zeit für ein Gespräch begrenzt ist, aber dafür brauchen wir keine Anmeldung, keinen Namen oder sonstige Angaben. Für diejenigen, die gern anonym bleiben möchten, kann das genau das Richtige sein.
Wer mit welcher Qualifikation in der Beratungsstelle sitzt, unterscheidet sich von Uni zu Uni. Eine bestimmte Ausbildung dafür gibt es nicht. Ich selbst bin Diplompsychologin mit einer Weiterbildung in Gesprächspsychotherapie. In meiner Beratung kommen daher auch therapeutische Elemente vor. Als Beraterin stelle ich aber keine Diagnosen und arbeite nicht streng therapeutisch.
Den Begriff „Beratungsstelle“ finde ich eigentlich irreführend. Meiner Erfahrung nach ist Beraten nichts, was den Leuten weiterhilft, wenn sie sich mit einem Problem an mich wenden. Meine Tätigkeit besteht zunächst erst einmal darin, den Menschen ein offenes Ohr zu schenken, ihre Gefühle wahrzunehmen und wertzuschätzen. Viele haben niemanden, dem sie sich anvertrauen können. Mit einer Person, die objektiv und unvoreingenommen ist, über Probleme zu sprechen, kann ein erster Schritt sein. Wenn ich meinem Gegenüber vermitteln kann: Es ist in Ordnung, wie du dich fühlst und dass du dich so fühlst – damit ist oft schon viel geholfen.
Grundsätzlich stehen jeder Person zehn kostenfreie Gesprächstermine zu. Einige kommen nur einmal, andere besuchen mich über einen längeren Zeitraum immer wieder. Es kommt auch vor, dass jemand einen Therapieplatz hat, aber ein Gesprächsangebot sucht, um die Zeit bis zum Beginn der Therapie zu überbrücken. Auch dafür sind wir da.
Einige Fälle übersteigen das, was im Rahmen der psychosozialen Beratung möglich ist. Etwa wenn ich den Eindruck habe, dass jemand eine Persönlichkeitsstörung hat. Ich würde auch nicht auf die Idee kommen, etwa ein Trauma anzugehen, dafür fehlt mir die Qualifikation. Glücklicherweise bin ich gut vernetzt mit Expertinnen und Experten sowie Fachkliniken in der Region. Wenn ich merke, dass etwas meine Möglichkeiten übersteigt, weiß ich, an wen ich mich wenden oder wohin ich vermitteln kann.
Nicole Arendt ist Leiterin der psychosozialen Beratungsstelle an der Universität Trier.
Das sind die Fakten
Was ist das für ein Angebot?
Psychologische Beratungsstellen gibt es an den meisten Hochschulen in Deutschland. Sie helfen Studierenden bei typischen Problemen wie etwa Prüfungsängsten und Schwierigkeiten mit der Abschlussarbeit, unterstützen aber auch in persönlichen Krisen. Neben der psychologischen gibt es die soziale und psychosoziale Beratung. Während die soziale Beratung finanzielle und rechtliche Fragen behandelt, ist der Begriff „psychosoziale Beratung“ nicht einheitlich geregelt.
Was kostet die Teilnahme?
Bis auf wenige Ausnahmen sind die Beratungsstellen ans jeweilige Studierendenwerk und nicht an die Hochschule angegliedert. Die Gesprächstermine sind in aller Regel kostenfrei. Kostenpflichtig können weiterführende Maßnahmen sein, die im Rahmen der Beratung empfohlen werden, wie etwa ein MBSR-Kurs. Studierende erhalten solche Angebote aber häufig vergünstigt.
Was sagt die Wissenschaft?
Studien an Universitäten konnten zeigen, dass der Besuch einer Beratung nicht nur stressmindernd wirkt. Auch das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit im Studium können sich verbessern, wenn Studierende unterstützende Gesprächsangebote aufsuchen. Laut Daten des Deutschen Studierendenwerks nahmen vergangenes Jahr 40000 Studierende Einzelgespräche in Anspruch. Insgesamt wurden 133000 Beratungskontakte gezählt.
Quellen
Dennis M. Kivlighan III u. a.: The role of mental health counseling in college students' academic success: An interrupted time series analysis. Journal of Counseling Psychology, 68/5, 2021, 562–570
Cheryl Regehr u. a.: Interventions to reduce stress in university students: A review and meta-analysis. Journal of Affective Disorders, 148/1, 2013, 1–11
Alan M. Schwitzer u. a.: Students with mental health needs: College counseling experiences and academic success. Journal of College Student Development, 59/1, 2018, 3–20
Francesca Vescovelli u. a.: University counseling service for improving students' mental health. Psycholocial Services, 14/4, 2017, 470–480
Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version dieses Artikels hieß es, die Beratungsstellen für Studierende in Leipzig, Mainz und Marburg seien nicht ans Studierendenwerk angegliedert. Diese Information ist falsch, wir haben den Text entsprechend korrigiert.
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? Wir freuen uns über Ihr Feedback!
Haben Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Beitrag oder möchten Sie uns eine allgemeine Rückmeldung zu unserem Magazin geben? Dann schreiben Sie uns gerne eine Mail (an: redaktion@psychologie-heute.de).
Wir lesen jede Nachricht, bitten aber um Verständnis, dass wir nicht alle Zuschriften beantworten können.