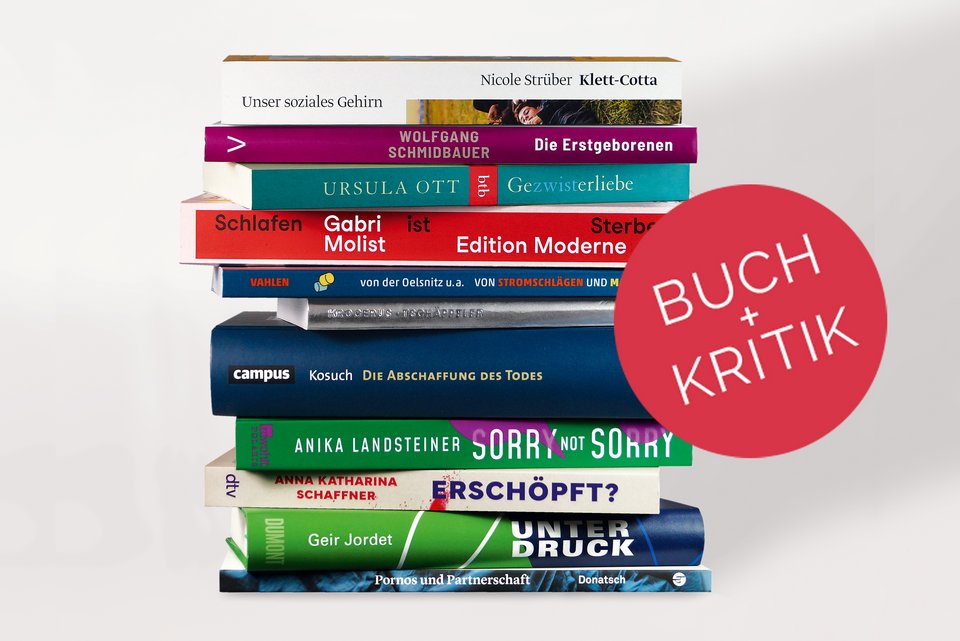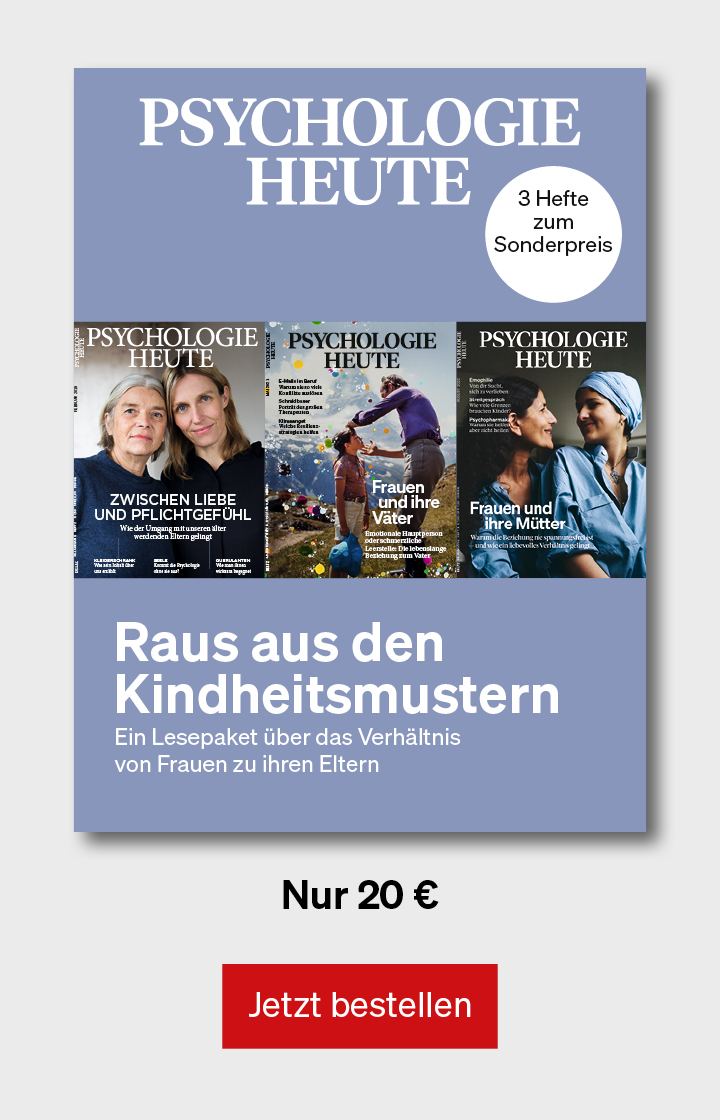„Geschwister sind schrecklich. Aber keine zu haben ist schlimmer.“ Dies sagt Wolfgang Schmidbauer manchmal zu seinen Patientinnen und Patienten, wenn die Rede auf Geschwisterkonflikte kommt. Und um die geht es in seinem neuen Buch. Das Besondere daran: Der Therapeut greift nicht nur auf Einsichten aus seiner analytischen Praxis zurück, sondern auch auf viele persönliche Erlebnisse mit dem älteren Bruder.
Auch die Journalistin Ursula Ott kann in ihrem Buch Gezwisterliebe Persönliches aus ihrer Beziehung zu der älteren Schwester beitragen. Dieser Rückgriff auf eigene Erfahrungen verleiht beiden Büchern eine besondere Authentizität.
„Entthronung“ der Erstgeborenen
Wolfgang Schmidbauer leuchtet vor allem die Rolle der Erstgeborenen aus, die – anders als mitunter angenommen – nicht automatisch die Selbstbewussten, die Gewinner sind. Sie müssen mit diversen Kränkungen und Ängsten zurechtkommen. Eindrucksvoll erzählt Schmidbauer von seinem zwei Jahre älteren Bruder Ernst, geboren 1939 und gestorben 2019. Zunächst gehörten ihm „Welt und Mutter“ allein, schreibt der Therapeut. Mit der Geburt des jüngeren Bruders „war klar, dass er beides teilen musste und das Ganze verloren hatte“ – Alfred Adler spricht hier von der „Entthronung“ der Erstgeborenen.
Er selbst, Wolfgang, konnte aus seiner Position viel Positives ziehen: Er „wusste von Anfang an, dass da neben der Mutter noch ein Gefährte war, den ich interessant fand, von dem ich lernen, mit dem ich spielen konnte“. Das Verhältnis der beiden Brüder war übrigens über große Strecken angespannt. Der Ältere, der sich früh für Naturwissenschaften interessierte, hat seinen Therapeutenbruder mal als „Blender“ bezeichnet, eine wenig schmeichelhafte Formulierung, über die Schmidbauer denn auch in seinem Buch mehrfach nachsinnt. Er wiederum empfand seinen Bruder als Grübler, vernünftig und sehr ernst – nomen est omen.
Schwierigkeiten, die eigenen Wünsche zu erkennen
An der frühen Zurücksetzung und Verunsicherung, die Erstgeborene erfahren müssen, mag es liegen, dass sie später dazu neigen, Beziehungen ordnen und kontrollieren zu wollen, wie Schmidbauer ausführt. Dadurch, dass sie als Kind ihre Bedürfnisse zugunsten des jüngeren Geschwisters zurückstellen mussten, haben sie auch später oft Schwierigkeiten, die eigenen Wünsche zu erkennen und auszuleben.
Der Autor zeigt vielschichtig die verschiedenen Facetten, die die Rolle der Erstgeborenen bestimmen. Dabei weist er klugerweise auf seine Neigung zur „(Über-)Pointierung“ hin, die auf seine therapeutische Arbeit zurückzuführen sei. Natürlich opfern nicht alle Erstgeborenen ihre Kindheit den Geschwistern, so der Psychologe, viele Faktoren wirkten hier zusammen, die eine Rolle konstituieren.
„Der Tollpatsch“ und „die Fürsorgliche“
Ursula Ott nähert sich dem Thema auf journalistische Weise, erzählt viele Beispiele von Geschwistern, die sie für ihre Recherche zu dem Buch getroffen hat, referiert Gespräche mit Psychologinnen und Psychologen, die sie interviewt hat. Auch sie schreibt aus der Perspektive der Jüngeren, ihre Schwester Biggi ist drei Jahre älter. In der Kindheit waren die Rollen klar verteilt: Ursula, die gern kletterte und sich ständig etwas brach, war „der Tollpatsch“, ihre Schwester „die Vernünftige“. Diese Schwester war aber auch die Fürsorgliche, die die Jüngere tröstete, wenn die sich wieder einmal wehgetan hatte.
Plastisch erzählt Ursula Ott, wie sich diese Rollen später aufgeweicht haben. Überhaupt zeige die Geschwisterforschung deutlich, dass die landläufigen Rollenzuschreibungen – die Älteren sind die Angepassten und Streberinnen, die Jüngeren die Rebellen – so nicht haltbar sind. Vielmehr komme es, so Ott, darauf an, „wie man seinen Rang bewertet“. Für die Erstgeborenen könne es sehr belastend sein, immer die Anführerinnenrolle übernehmen zu müssen – oder es mache ihnen eben Freude, den jüngeren Geschwistern etwas beizubringen.
Kontaktabbruch mit den Geschwistern
Ausführlich widmet sich Ott der Frage, wie aus Geschwistern schließlich „Gezwister“ werden, wie es also zu Streit oder sogar Kontaktabbruch kommen kann. Oft sind Diskussionen um Geld, Erbansprüche oder die Pflege der alten Eltern nur Vehikel, mit denen Konflikte ausgetragen werden, die auf alte Verletzungen zurückgehen. So wie bei Gerd, einem plastischen Chirurgen, der mit seinen beiden älteren Brüdern gebrochen hat. In seiner Kindheit musste er damit zurechtkommen, dass sein ältester Bruder der „Augenstern“ der Mutter war, er selbst fühlte sich immer zurückgesetzt. Wie kommt man da raus, wie kann Aussöhnung gelingen? Auch hier dürfte es sinnvoll sein, die eigene Rolle genauer zu reflektieren.
Die Stoßrichtung von Ursula Otts Buch ist eindeutig: Die Journalistin rät zur Versöhnung, denn letztlich machten erbitterte Streitigkeiten oder Kontaktabbrüche keinen glücklich. Auch wenn sie explizit schreibt, dass Gezwisterliebe kein Ratgeber sein will, gibt sie doch einige praktische Tipps, etwa wie man ein Familientreffen organisiert.
Mitunter fehlt es in dem salopp und schwungvoll geschriebenen Buch etwas an Struktur. Dafür bekommen wir durch die vielen Beispiele sehr lebendige Einblicke, wie Geschwister ticken und gelegentlich austicken. Wolfgang Schmidbauer wiederum greift vor allem auf seine Erfahrungen als Therapeut zurück. Die zahlreichen Beispiele aus Musik, Kunst und Literatur, die er anführt, sind eine zusätzliche Bereicherung.
Wolfgang Schmidbauer: Die Erstgeborenen. Wie sie ihre Kindheit den Geschwistern opfern. Bonifatius 2024, 192 S., € 18,–
Ursula Ott: Gezwisterliebe. Vom Streiten, Auseinandersetzen und Versöhnen. Btb 2024, 208 S., € 17,–
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? Wir freuen uns über Ihr Feedback!
Haben Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Beitrag oder möchten Sie uns eine allgemeine Rückmeldung zu unserem Magazin geben? Dann schreiben Sie uns gerne eine Mail (an: redaktion@psychologie-heute.de).
Wir lesen jede Nachricht, bitten aber um Verständnis, dass wir nicht alle Zuschriften beantworten können.