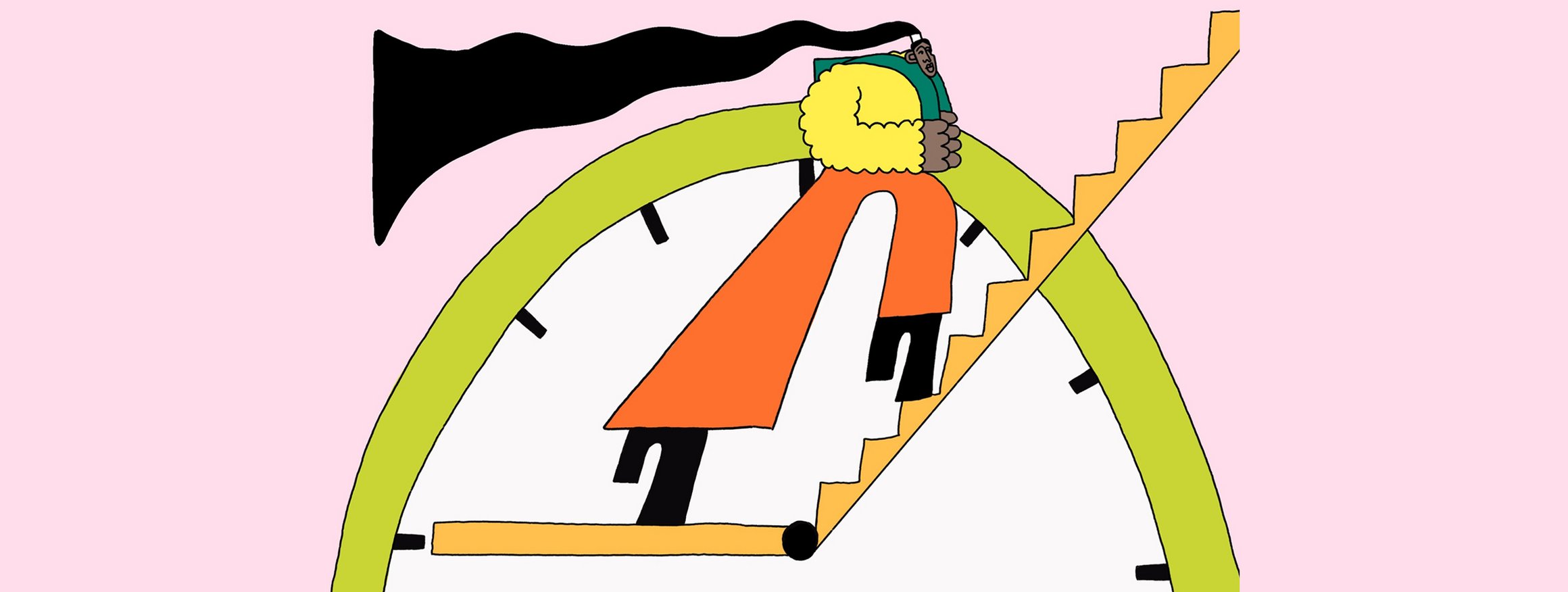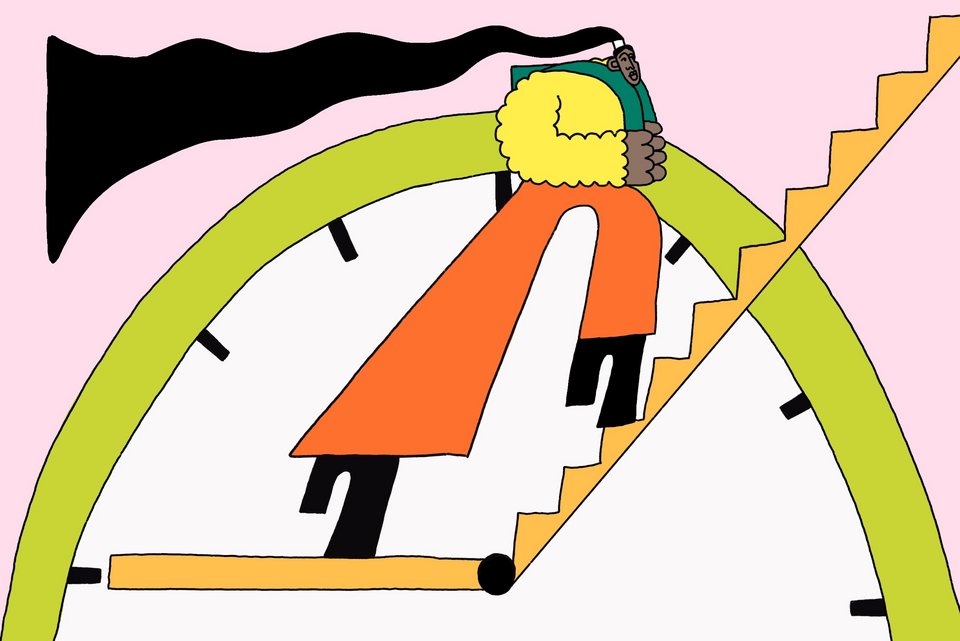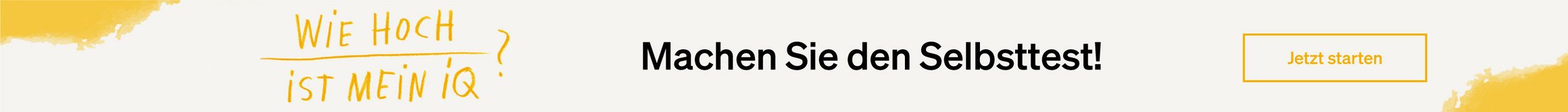Frau Z. will gerne noch länger bleiben. Das fällt mir zuerst in unseren Sitzungen auf, die meistens länger dauern als mit ihren Mitpatientinnen auf der Therapiestation. Ob es ein Tränenausbruch am Ende ist, ein neu aufkommendes Thema, oder einfach nur das „Vergessen“ der Zeit – unsere Gespräche beende ich selten pünktlich. Das liegt auch daran, dass Frau Z. mich immer ganz verletzt anschaut, wenn sie mich beim Blick auf die Uhr beobachtet.
Ich erinnere mich noch sehr eindrücklich an die Erstsemester-Einführung meines Studiums. Unter anderem sollten wir erzählen, was uns zum Studium motiviere. „Menschen helfen“, war die häufigste Antwort. Auch die Selbstbeschreibungen ähnelten sich: „Ich war schon immer eine Person, der andere gern ihre Probleme erzählen.“ Tatsächlich mag ich an meinem Job kaum etwas so sehr wie das Gefühl nach einer gelungenen Sitzung, wenn die andere Person erleichtert und bestärkt mein Büro verlässt.
Frau Z. will gerne noch länger bleiben. Deshalb schenke ich ihr zehn zusätzliche Minuten oder ein kurzes Gespräch auf dem Gang. Deshalb tue ich ihr den Gefallen und blicke in der Sitzung nicht auf die Uhr. Schließlich möchte ich ihr helfen und nicht Schmerz zufügen.
Doch dann sehe ich ein Video mit der Psychoanalytikerin Nancy Williams, in dem sie über Patienten spricht, die unsere Grenzen ausloten: „Very often what feels like a test of whether we can be flexible, it’s really a test: are you going to rationalize changing the rules on me […]?”. Sie erläutert, dass Menschen, die in ihrer Biografie immer wieder Unverlässlichkeit und Verletzungen durch zentrale Bezugspersonen erlebten, herauszufinden versuchen, ob sie beim therapeutischen Gegenüber sicher sind. Williams spricht über den Umgang mit Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung und bringt mir doch etwas Grundsätzliches über meine Arbeit bei. In dem Moment, indem ich zuvor besprochene Regeln verletze, werde ich ein unzuverlässiges Gegenüber. Ich gestalte einen Rahmen, indem das Verhalten der Patientin darüber entscheidet, wie lang unser Gespräch geht. Sie kann sich nicht in der Gewissheit entspannen, eine gleichbleibende Wertschätzung und Gesprächszeit von mir zu erhalten. Trotz meiner wohlwollenden Absicht erschwere ich den Aufbau von Vertrauen.
Das lässt mich nicht nur die Arbeit mit Frau Z., sondern auch mein therapeutisches Selbstverständnis hinterfragen. Früher dachte ich, dass meine Freundlichkeit und Freigiebigkeit eine solide Basis für mein therapeutisches Handwerk sein würden. Daran, dass gute Beziehungen auch Grenzen erfordern, dachte ich nicht.
Frau Z. berührt einen Punkt in mir, der auch in meinen privaten Beziehungen eine Rolle spielt. Fast nie spreche ich ein deutliches „Nein“ aus. „Klar kann ich dir nach der Arbeit noch zwei Stunden zuhören“, „Ja, ich komme mit ins Kino“, „Ja, den Papierkram schiebe ich schon noch dazwischen, lass die Akte bei mir liegen“. Mir war zwar klar, dass dieses Verhalten mir selbst schadete, aber dass es auch anderen schaden könnte, ist neu für mich. Und doch, sagt eine zögerliche Stimme in mir, kann sich mein Gegenüber nicht darauf verlassen, dass ich ehrlich mit ihm bin.
Seitdem habe ich einen anderen Blick auf Grenzen. Während ich Freundlichkeit und Ehrlichkeit früher oft als Unvereinbarkeiten wahrnahm, weiß ich heute, wie sehr wir beides zusammen brauchen. Liebende Grenzen geben ein Gefühl von Sicherheit und stärken unsere Beziehungen. Sogar eine unangenehme Rückmeldung kann unendlich bereichernd sein, weil wir die Möglichkeit zur Veränderung erhalten.
Die Dauer der Sitzungen mit Frau Z. halte ich jetzt besser ein. Doch auch heute will sie länger bleiben: Sie möchte ihren stationären Aufenthalt verlängern. Ihre persönlichen Therapieziele habe sie erreicht, aber in der Patientinnengemeinschaft fühle sie sich so wohl, dass sie die Behandlung nicht früher beenden wolle, als ihre Zimmernachbarinnen.
Ich atme durch und sage: „Ich verstehe ihr Bedürfnis gut. Ich möchte den Entlasstermin dennoch beibehalten.“ Frau Z. bricht in Tränen aus, was ich nur schwer aushalten kann. Doch ich bleibe bei der Entscheidung. Nach einer Weile beginnt sie zu sprechen. Sie sei wütend und traurig. Nachdem wir diese Gefühle anerkannt und eingeordnet haben, gibt sie leise zu, auch ein wenig erleichtert zu sein. Interessiert frage ich nach. Obwohl es schrecklich für sie sei zu gehen, spüre sie auch, wie gut ihr die Gewissheit tue. Es werde ein klares Ende geben. Kein langes, uneindeutiges Herauszögern. Und vor allem: Keinen kräftezehrenden Kampf um mehr Aufmerksamkeit und Behandlungszeit.

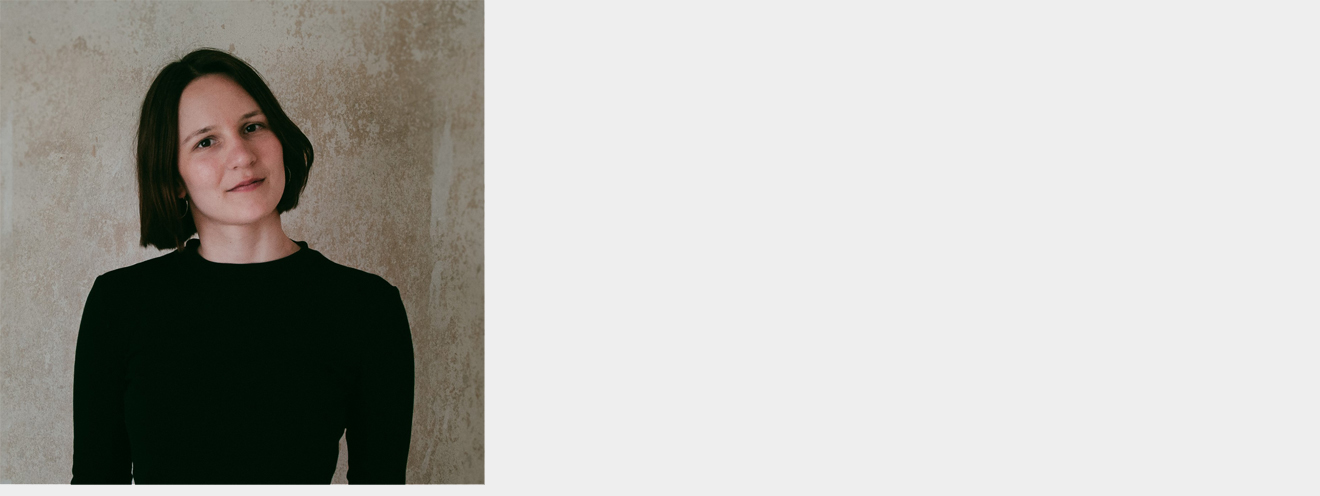
Transparenz-Hinweis: Es gibt keine Therapeutin ohne Patientinnen – deshalb erzählt diese Kolumne von Menschen in der Psychiatrie. Da der Schutz der Behandelten an oberster Stelle steht, werden die Fallbeispiele bezüglich ihrer soziodemographischen und biografischen Daten stark verändert und erscheinen mit zeitlichem Abstand. Die berichteten Begegnungen bleiben in ihrem emotionalen Kern erhalten.