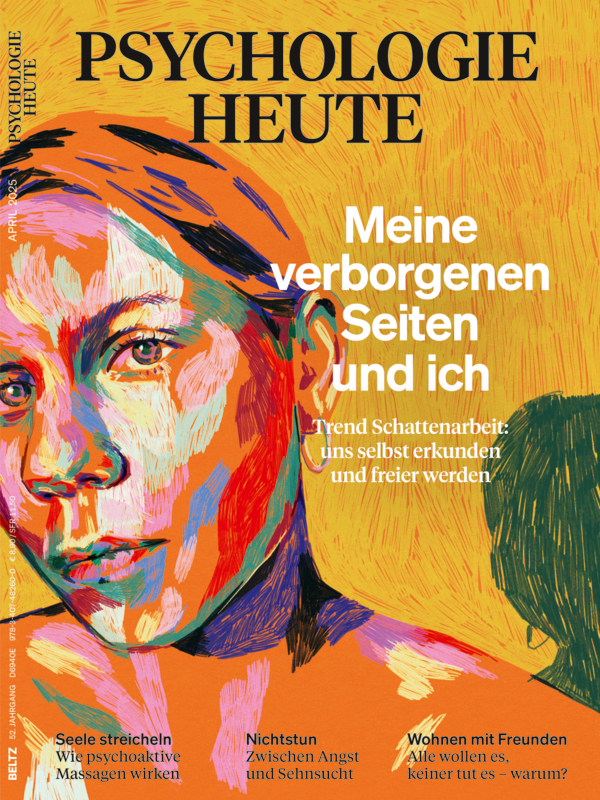Megan Sumeracki und Althea Need Kaminske sind Gedächtnisforscherinnen. Wenn die beiden Psychologieprofessorinnen aus Rhode Island und Indiana das unvorsichtigerweise in einem Smalltalk erwähnen, ist die erste Reaktion oft ein Lamento: „Oh, mein Gedächtnis ist wie ein Sieb.“ Die Klage ist verständlich. Wer ärgert sich nicht, wenn wieder mal der Schlüssel unauffindbar ist oder einem partout der Name des Gegenübers nicht einfallen will. Hätte ich doch nur das perfekte Erinnerungsvermögen! Doch es ist wie bei der Fee: Beim Wünschen ist Vorsicht geboten. Denn außergewöhnliche Gedächtnisleistungen haben ihre Tücken, wie Megan Sumeracki und Althea Need Kaminske in ihrem Buch The Psychology of Memory an fünf Beispielen deutlich machen.
Mehr noch: Die Forscherinnen unterstreichen, wie wichtig das Vergessen ist, um im Kopf Erhaltenswertes verfügbar zu machen.
1 Eidetisches Gedächtnis
Stellen Sie sich vor, Sie betrachten ein Bild, legen es beiseite – und dennoch ist das Gesehene noch immer lebhaft und in allen Einzelheiten vor Ihrem inneren Auge präsent. Auf Nachfrage können Sie zum Beispiel angeben, wie viele Streifen der Schwanz der Katze hatte, die da rechts in der Szenerie kauerte: Sie müssen es ja nur an Ihrem Vorstellungsbild abzählen.
Eine solche Gabe sagt man Menschen mit einem fotografischen oder „eidetischen“ Gedächtnis nach (von griechisch eidos: Sehen, Form, Bild). Meist sind das Kinder. Laut Studien kann etwa jedes zwanzigste Kind ziemlich detaillierte Vorstellungsbilder für eine Weile im Kopf behalten. Legt man allerdings strengere Kriterien an, ist ein eidetisches Gedächtnis auch bei Kindern extrem selten.
Und die Tatsache, dass sich diese Begabung bis zum Erwachsenenalter meist auswächst, lässt vermuten, dass sie in der kognitiven Entwicklung gezielt eliminiert wird. Das ist auch sinnvoll, meinen Sumeracki und Kaminske, denn beim Lernen kommt es weniger darauf an, Details zu reproduzieren, sondern zu generalisieren und Wissen in Konzepten zu organisieren: „Wenn wir den Klassenraum betreten, müssen wir nicht jedesmal lernen, dass jeder dieser Stühle ein Stuhl ist, auf den wir uns setzen können.“
2 Hyperthymesie
Auch das hyperthymestische Syndrom oder highly superior autobiographical memory (HSAM) ist sehr selten. Die Betreffenden tragen lebhafte und detaillierte Erinnerungen an beliebige Ereignisse aus ihrem Leben mit sich herum, zum Beispiel an Einzelheiten einer bedeutungslosen Zugfahrt. Die meisten empfinden diesen Zustand eher als Fluch denn als Segen.
Eine betroffene Frau namens Jill Price beschreibt ihr Gedächtnis als „unkontrollierbar, tyrannisch und ermüdend“. Ihre Erinnerungen seien „wie Szenen eines Privatfilms von jedem Tag meines Lebens, die ständig in meinem Kopf abgespielt werden und dabei unablässig vor und zurück durch die Jahre springen und mich, allein ihrer Willkür folgend, zu jedem beliebigen Moment führen“.
Leider wird diese Zumutung nicht einmal durch Vorteile aufgewogen, denn HSAM ist eine hochspezialisierte Leistung. In Tests zu anderen Gedächtnisfunktionen – etwa beim Aufzählen von Gemüsesorten oder Tierarten – scheiden die Betreffenden nicht besser ab als der Durchschnitt.
3 Savantsyndrom
Menschen mit einem Savantsyndrom haben eine „Inselbegabung“: Sie brillieren auf einem Spezialgebiet, obwohl sie insgesamt kognitiv eingeschränkt sind. Umso mehr sticht ihr Sondertalent hervor. Manche können außerordentlich gut zeichnen oder rechnen, andere haben ein fantastisches Verständnis für Musik.
Die häufigste Inselbegabung aber betrifft das Gedächtnis: Die Betreffenden rufen ohne erkennbare Anstrengung ein beeindruckendes Konvolut von Detailwissen aus ihrem Interessensgebiet ab, etwa Höchstgeschwindigkeit und Antriebsleistung sämtlicher gängiger Schiffsmodelle oder den Tabellenstand der Bundesliga am Saisonende 1978. Doch es mangelt an der Einordnung all dieser Informationen in einen Kontext – also zum Beispiel, warum ein bestimmtes Schiff auf eine bestimmte Weise konstruiert war und welche Aufgaben es erfüllte.
4 Super-Recognizer
In diese Kategorie fallen Menschen, die einmal gesehene Gesichter mit hoher Sicherheit wiedererkennen – sogar dann wenn sie nur einen kurzen zufälligen Blick erhaschen konnten, und selbst das vor geraumer Zeit. Sie erinnern sich zum Beispiel an das Antlitz der Frau in der Warteschlange am Flughafenschalter beim Urlaub vor zwei Jahren, als wäre es eine alte Bekannte. Diese besondere Gabe macht Gesichtserkennungstalente für den Einsatz bei der Strafverfolgung interessant, etwa wenn es gilt, auf Fotos von Überwachungskameras zur Fahndung ausgeschriebene Personen ausfindig zu machen.
Erfolgreiche Pilotprojekte gab es auch in Deutschland. Doch nährten manche Studien Zweifel, ob die Wiedererkennungsquote von Super-Recognizern wirklich dramatisch die von Normalsterblichen übertrifft. Ihre Urteile sind jedenfalls nicht zuverlässig genug, um als Beweismittel vor Gericht dienen zu können. Das Gegenstück zu den Gesichtserkennungsgenies sind übrigens Menschen mit einer Prosopagnosie, die selbst die Gesichter ihrer Liebsten nicht identifizieren können und sich stattdessen etwa am Klang der Stimme orientieren.
5 Gedächtnisstars
Die meisten der außergewöhnlichen Gedächtnisleistungen sind gar keine. Sie muten nur so an, weil sie uns heftig beeindrucken. Ein Mann namens Shijir-Erdene Bat-Enkh etwa brachte es im Jahr 2018 auf der Korea Open Memory Championship fertig, sich die Reihenfolge von 52 durchmischten Spielkarten in 12,74 Sekunden korrekt einzuprägen. Weltrekord, Chapeau! Allerdings verfügen solche Gedächtnischampions wie er keineswegs über ein besonderes Hirnmodul. Ihre verblüffende Performance beruht auf hartnäckigem Training mithilfe einer Mnemotechnik – einer komplexen Architektur aus Eselsbrücken.
Die bekannteste ist die Loci-Methode: Man platziert die zu memorierenden Objekte der Reihe nach in einem imaginierten Raum oder Gebäude – einem „Gedächtnispalast“ – und verknüpft sie in einer kleinen Geschichte. Sie könnten sich zum Beispiel Ihre Einkaufsliste ungefähr so einprägen: Kaum daheim angekommen, rutschen Sie im Flur auf einer Bananenschale aus; darauf erst mal einen Schluck Milch aus dem Glas dort auf der Ablage – aber pfui, wer hat denn da Salz hineingeschüttet! Je interaktiver und bizarrer der imaginierte Plot, so die beiden Gedächtnisforscherinnen, desto besser fürs Erinnern. Solche Mnemotechniken funktionieren prima beim Einprägen von Listen, Karten oder Ziffern. Aber sie stoßen an ihre Grenzen, sobald es ums Verstehen geht. Biochemie oder Quantenphysik kann man damit schwerlich lernen.
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? Wir freuen uns über Ihr Feedback!
Haben Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Beitrag oder möchten Sie uns eine allgemeine Rückmeldung zu unserem Magazin geben? Dann schreiben Sie uns gerne eine Mail (an: redaktion@psychologie-heute.de).
Wir lesen jede Nachricht, bitten aber um Verständnis, dass wir nicht alle Zuschriften beantworten können.
Quelle
Megan Sumeracki, Althea Need Kaminske: The Psychology of Memory. Routledge 2024