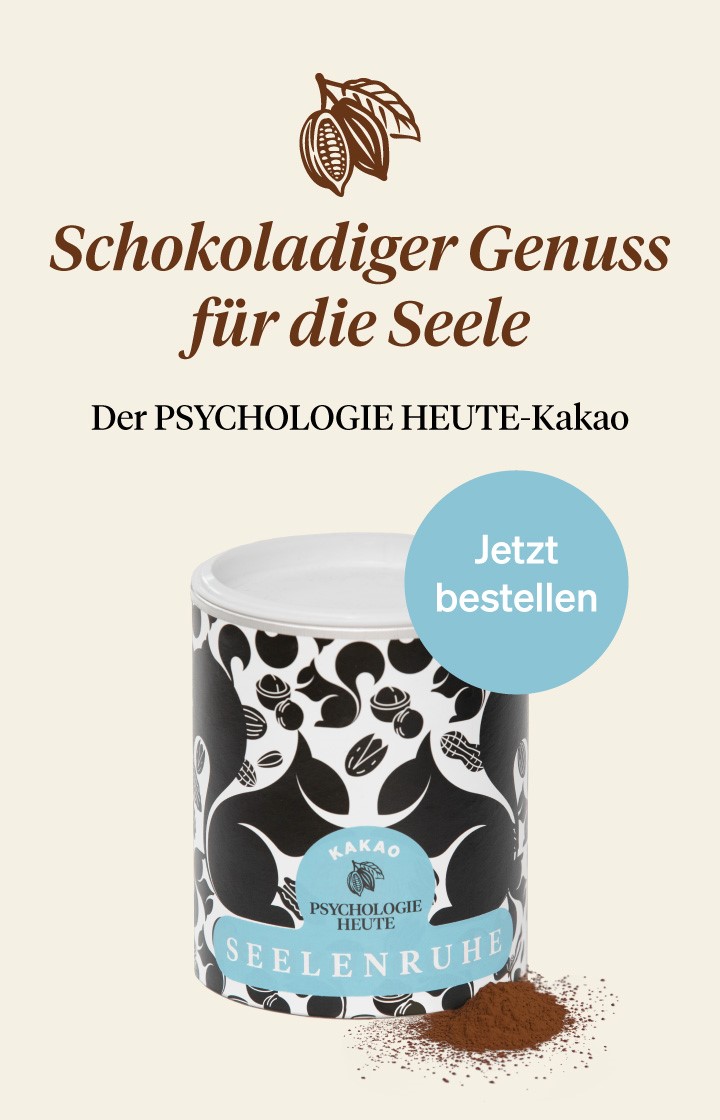Frau Bräuer, Sie befassen sich unter anderen damit, wie sich das Denken bei Tieren im Laufe der Evolution entwickelt hat. Wie muss ich mir das vorstellen?
Das Wort „Denken“ ist uneindeutig. Im Zusammenhang mit der Evolution von Hunden oder auch Schimpansen geht es uns um Kognition, also Erkenntnisvermögen. Wir fragen also nicht: Was lernt ein Tier oder welche Fähigkeit ist angeboren, sondern: Was versteht es? In unserem Fach der vergleichenden Psychologie befassen wir uns mit einzelnen, speziellen Fähigkeiten.
Artikel zum Thema
Ein Beispiel: Schimpansen verstehen, dass sie sich nicht bemühen müssen, Energie zu investieren, eine hohle Nuss zu öffnen. In Experimenten zeigen sie, dass sie verstehen, dass das Belohnungsfutter im Becher beim Schütteln ein Geräusch erzeugt. Daher wissen sie auch, dass das Futter nicht drin sein kann, wenn man nichts hört, und sie müssen nicht zu viel Zeit und Kraft in die Nahrungssuche investieren. Wir nennen das physikalische Kognition und meinen damit das Verständnis der physischen Welt. Als Art sind Schimpansen eher kompetitiv und weniger kooperativ. Hunde dagegen tun sich im Experiment schwer, den kausalen Zusammenhang zwischen Geräusch und Inhalt eines Gefäßes zu verstehen.
Inwiefern sind Hunde anders?
Hunde nutzen beispielsweise menschliche Zeigegesten sehr gut. Das gehört aus unserer Sicht zur sozialen Kognition. Eine Zeigegeste versteht der Hund vielleicht als Information: „Ich will mit dir sprechen, dich auf etwas aufmerksam machen“, vielleicht aber auch als Befehl. Schon Welpen im Alter von sechs Wochen nutzen sie. Das Zeigen gilt übrigens als eine der wichtigsten Gesten auch in der menschlichen Kommunikation. Mein Doktorvater Michael Tomasello hat ein ganzes Buch darüber geschrieben.
Wir vermuten, dass Menschen seit jeher Hunde ausgewählt haben, die Menschen gut deuten konnten. Das war für die Hunde ein Überlebensvorteil. Ursprünglich sind Hunde wahrscheinlich für die Jagd domestiziert worden, also dafür, uns zu begleiten und zu unterstützen. Sie sind motiviert, uns zu helfen. Allerdings verstehen sie die Situation oft nicht gut, sie wissen nicht, was genau sie tun sollen. Hunde haben keine voll ausgebildete theory of mind. Sie können sich nicht in Menschen hineinversetzen wie Schimpansen das können.
Studien haben gezeigt, dass bei Menschen und Hunden, die sich anschauen, das Bindungshormon Oxytocin ausgeschüttet wird. Es scheint sich wirklich um eine sehr enge Beziehung zu handeln.
Ja, aber Hunde sind nicht unsere besten Freunde, denn mit ihnen diskutiert man nicht. In dieser Beziehung muss der Mensch das Sagen haben. Wir schätzen Hunde auch manchmal falsch ein. So glauben wir mitunter, dass Hunde über ein Schuldbewusstsein verfügen, was nicht stimmt. Sie wirken mitunter so. Aber das bedeutet nur, dass sie sich unterwerfen, weil sie wahrnehmen, dass „ihr Mensch“ wütend auf sie ist.
Juliane Bräuer ist Forscherin am Max-Planck-Institut für Geoanthropologie in Jena.
Quellen
Juliane Bräuer, Yana Bender: Warum die Vergleichende Psychologie auf den Hund gekommen ist. Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie, 2023. DOI: 10.1026/0049-8637/a000267
Juliane Bräuer u.a.: Old and new approaches to animal cognition: There is not “one cognition”. Journal of Intelligence, 2020. DOI: 10.3390/jintelligence8030028