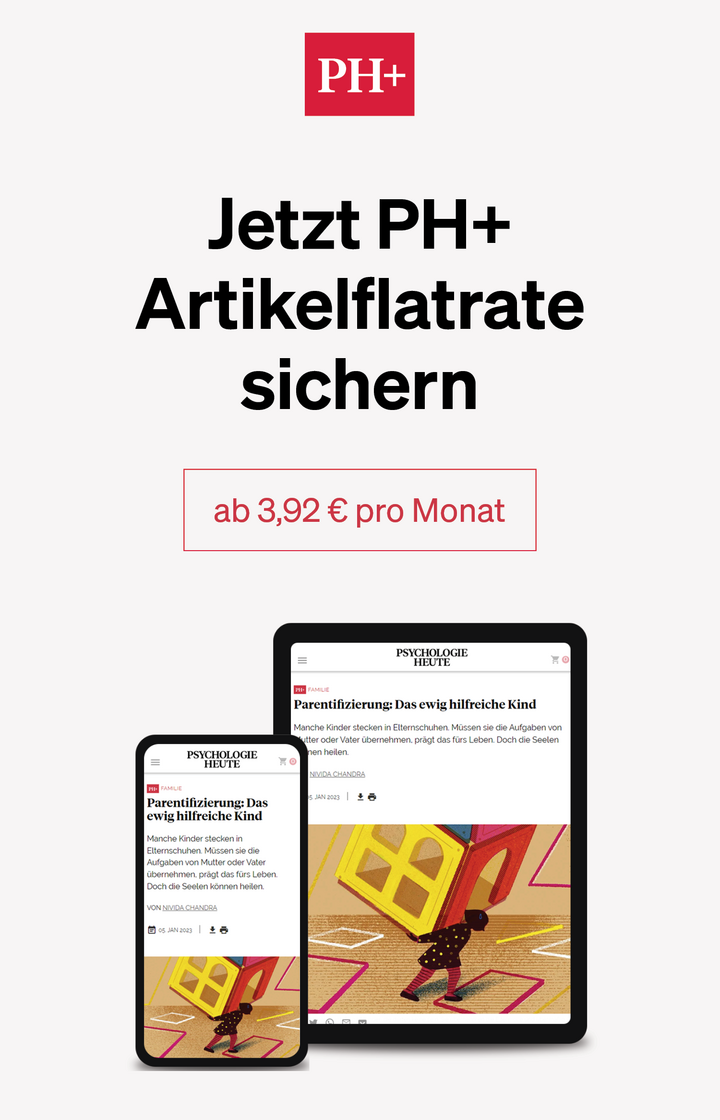Herr Ullrich, eine gängige Kritik an Selfies lautet: Wir leben im Zeitalter der digitalen Selbstinszenierung, deswegen achten immer mehr Menschen auf das Bild, das sie abgeben, auf die Oberfläche, und leben nicht mehr authentisch. Wie beurteilen Sie das? Sind wir heute weniger authentisch, weil wir getrieben sind von der Suche nach dem nächsten Selfie?
Wenn man diese Art von Kritik übt, geht man davon aus, dass der Mensch so etwas wie einen inneren Wesenskern hat, eine eigentliche, vielleicht auch unveränderliche Identität. Und man hat das Ideal, dass es Formen des Ausdrucks gibt, bei denen dieses wahre Wesen zum Vorschein kommt. Das halte ich allerdings für ein Menschenbild, das sowohl in historischer als auch in kultureller Hinsicht beschränkt ist. Unser Begriff von Authentizität hat sich in den westlichen Kulturen vor allem in der Romantik entwickelt. Ich sehe heute aber viel stärker ein anderes Menschenbild dominieren, in dem der Mensch sich begreift als die Summe seiner Inszenierungen und Rollen, seiner Möglichkeiten, in ganz verschiedenen Situationen zu bestehen. Das Selbst ist also viel pluraler und variabler. Und dann ist Authentizität auch nichts mehr, das unverbrüchlich feststeht oder Ausdruck einer vorgegebenen Identität ist. Sondern authentisch ist demnach vielleicht eher das, was in der jeweiligen Situation das Angemessene, das Passende ist. Wenn etwas spontan gelingt, etwas schlagfertig ist, wenn etwas auf den Punkt gebracht ist, dann wäre es vielleicht eher als authentisch zu beurteilen als wenn etwas vermeintlich Grundlegendes zum Ausdruck kommt.
Hieße das auch, dass ohne Inszenierung Authentizität gar nicht hergestellt werden kann?
Genau. Es gibt Inszenierungen, die sind vielleicht nur eine Pose, eine schlechte Form von Übertreibung. Über die würde man sicher sagen: Die sind nicht authentisch. Aber vielleicht gibt es das eine Bild – mit dem einen Filter, der einen digitalen Maske –, das in einer bestimmten Situation besser als alles andere eine Stimmung oder einen Wunsch zum Ausdruck bringt. Bei dem der Empfänger das Gefühl hat: Jetzt habe ich wirklich etwas verstanden von diesem anderen Menschen in diesem einen Moment. Dann würde man ja sagen: Es ist authentisch. Obwohl es gleichzeitig eine krasse Form der Inszenierung ist.
Was war denn in der Romantik das Medium, in dem das wahre Selbst seinen passenden Ausdruck fand?
Ein Tagebuch war so ein Medium, Lyrik war so ein Medium, alles, wo eine gewisse Intimität im Spiel ist, wo der Eindruck entsteht: Da äußert sich jemand ungestört – ungestört von den Erwartungen anderer, ohne gesellschaftlichen Konventionen zu folgen. Wir haben in der Romantik ja auch die Idee des autonomen Kunstwerks, die plötzlich groß wird, also die Idee einer Kunst, die keine Kompromisse eingehen muss, die sich eben nicht mit äußeren Bedingungen arrangiert, sondern die ganz aus dem Inneren des Künstlers heraus kommt. Das autonome Kunstwerk ist nach dieser Idee das authentische Kunstwerk. Daher war auch eher die Zeichnung als das Auftragsgemälde gefragt, eher die Kammermusik als die große Sinfonie.
In der Romantik ging der Weg der Authentizität also von innen nach außen. Ist es heute so, dass man durch die Inszenierung etwas über sich selbst erfährt?
Genau, heute geht es eher von außen nach innen. Natürlich gibt es trotzdem so etwas wie ein Wesen, eine Identität. Aber die konstituiert sich eher aus der Summe an Inszenierungen, an Rollen, die man einnimmt. Während man in der Folge der Romantik immer gesagt hätte: Die Rollen, die man spielt, sind nur etwas Äußerliches, etwas Verfälschendes, das ist nicht das Eigentliche. Diese Zweiteilung zwischen dem Eigentlichen und dem bloß Inszenierten, die lange Zeit gültig war, wird nun zunehmend in Frage gestellt. Das hat sicher auch damit zu tun, dass die Trends in den digitalen Medien nicht nur von Menschen gemacht werden, die in westlichen Ländern sozialisiert sind. Sondern genauso von Menschen aus anderen Kulturen mit anderen Menschenbildern, die vielleicht von vornherein gar keinen Begriff von Authentizität haben – oder einen ganz anderen.
Ist das romantische Authentizitätsideal heute auch so eine Art Sehnsuchtsbild, weil die Menschen so stark vernetzt sind?
Ich denke, in den meisten Menschen sind beide Ideale angelegt: Wir haben heute auf der einen Seite all die Formen von Wellness, bei denen es darum geht, sich zurückzuziehen, Reize zu dimmen, den Kontakt zur Umwelt zu minimieren, nach innen zu gehen – in der Hoffnung, dort etwas zu entdecken. Und wir haben auf der anderen Seite das Ideal des super-vernetzten Menschen, der sich in unterschiedlichen Milieus und Situationen zu bewegen versteht, der so eine Art von Sprezzatura besitzt, also souverän immer das genau Angemessene tut und gerade dadurch Freiheit und Unabhängigkeit beweist. Es hängt vom individuellen Typus ab, ob man mehr das eine oder das andere verfolgt.
Ist das neue Verständnis von Authentizität auch mosaikhafter und temporärer als das romantische Ideal?
Auf jeden Fall ganz temporär. Wenn ein Trauerredner es zum Beispiel schafft, nicht nur konventionelle Floskeln zu sagen, sondern mit wenigen Worten, mit einer Geste die Stimmung, die Trauer, das Besondere des Menschen, den man gerade beerdigt, auf den Punkt zu bringen. Das wäre dann authentisch. Oder ein Twitter-Nutzer, dem es gelingt, auf einen Tweet schlagfertig mit einer Bemerkung oder einer Kombination von Emojis so zu reagieren, dass andere gleich das Gefühl haben: Das ist jetzt genau die richtige Reaktion, da hat jemand etwas kapiert und das auch so zum Ausdruck gebracht. Dieser besondere Moment, der spürbar wird: das ist für mich ein alternativer Begriff von Authentizität. Aber genau wie Sie sagen: Das ist etwas sehr Momenthaftes und auch im Moment Aufgehendes. Es kann sein, dass man davon am nächsten Tag erzählt bekommt und überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, was daran so besonders gewesen sein soll.
Ein weiteres gängiges Vorurteil über Selfies ist ja, dass wir sie immer in Bezug auf andere Menschen, auf ein Publikum hin erstellen und dass damit schon Authentizität eingebüßt wird, weil das Publikum mitgedacht wird. Wie beurteilen Sie diese Kritik?
Da sehen wir erneut, dass diese Kritik von einem Menschenbild her formuliert ist, das davon ausgeht, dass etwas völlig Autonomes aus dem Menschen heraus geschaffen wird. Das andere, konträre Verständnis wäre, dass jemand – wie beschrieben – aus einer spezifischen Situation heraus und auch nur für diese eine Situation gültig eine überzeugende Reaktion bietet. Also der alternative Authentizitätsbegriff, den ich hier etwas stark zu machen versuche.
Wer keine Selfies macht, könnte unter Narzissmus-Verdacht stehen, schreiben Sie. Das müssen Sie erklären.
Eine beliebte Deutung des antiken Mythos lautet ja, dass Narziss nur deshalb in die Wasserfläche schaute, weil er alle Menschen um sich herum unattraktiv fand und keinen Kontakt mit ihnen haben wollte. Heute könnte man sagen: Jemand, der keine Selfies macht, ist vielleicht jemand, dem die anderen Menschen nicht wichtig genug sind, um ihnen diese kleinen Geschenke oder Gaben zu machen. Weil er so auf sich bezogen ist, dass ihm die anderen egal sind. Insofern könnte jemand, der keine Selfies macht, eher ein Narzisst sein als jemand, der andere oft mit Selfies beglückt.
Sie zitieren in ihrem Buch Selfies den Soziologen Richard Sennett mit dem Satz, dass erst in der Moderne „Theatralität in einem feindlichen Verhältnis zur Intimität“ stehe. Würden Sie sagen, dass durch die Inszenierung einer Rolle auch so etwas wie Nähe zu anderen Menschen entsteht?
In gewisser Weise kann das schon sein, weil man durch Theatralität bestimmte Emotionen wecken, einüben oder verstärken kann. Und insofern vielleicht auch Formen von Intimität geübt werden müssen durch Formen des Rollenspiels oder der Inszenierung. Ich bin ein Anhänger der Thesen der Soziologin Eva Illouz, die ja vom Konsum der Romantik spricht und herausarbeitet, wie sehr gerade die romantischen, intimen Gefühle sich ganz äußerlichen Dingen verdanken, zum Beispiel dem Candlelight Dinner, das ja auch erstmal eine sehr inszenierte, theatralische Form ist. Die These von Illouz ist, und da würde ich mich anschließen: Nur durch solche Formen von Inszenierung kann man letztlich vermeintlich ganz innerliche und intime Gefühle überhaupt erst entwickeln.
Könnten Sie sich vorstellen, dass sich durch das Inszenieren von sehr theatralischen Gesichtsausdrücken auf Selfies unsere Emotionalität verändert?
Ich glaube ja. Ich beschäftige mich nicht sehr viel, aber immer wieder mit YouTubern. Und da fällt mir auf, dass sie sich in ihrer Mimik gerne an Emojis orientieren. Und sie versuchen auch, verschiedene Emojis zu kombinieren. Das führt zu Gefühlsausdrücken, die wir nicht als natürlich empfinden, bei denen wir erst einmal sagen: Das Gefühl gibt es doch gar nicht! Ich kann doch nicht gleichzeitig schreiend und liebevoll gucken. Aber genau so etwas versuchen einige. Vielleicht am Anfang noch als Challenge oder mit dem Bedürfnis, ein mimisches Alleinstellungsmerkmal zu entwickeln. Aber ich glaube, so etwas geht in ein eigenes emotionales Empfinden über, so dass hier Gefühle auch neu designt werden können.
Das wird ja interessant zu sehen, welche Art von Emotionalität sich in den nächsten Jahren entwickelt.
Absolut, ja. Man kann rückblickend sehen, wie stark sich über die Jahrhunderte hinweg Mimik und Gestik verändert haben. Und wir sind in einer Phase, in der ein größerer Schub oder eine größere Metamorphose hinsichtlich unserer emotionalen Kodierung stattfindet.
Das Buch von Wolfgang Ullrich heißt Selfies und ist im Verlag Klaus Wagenbach erschienen