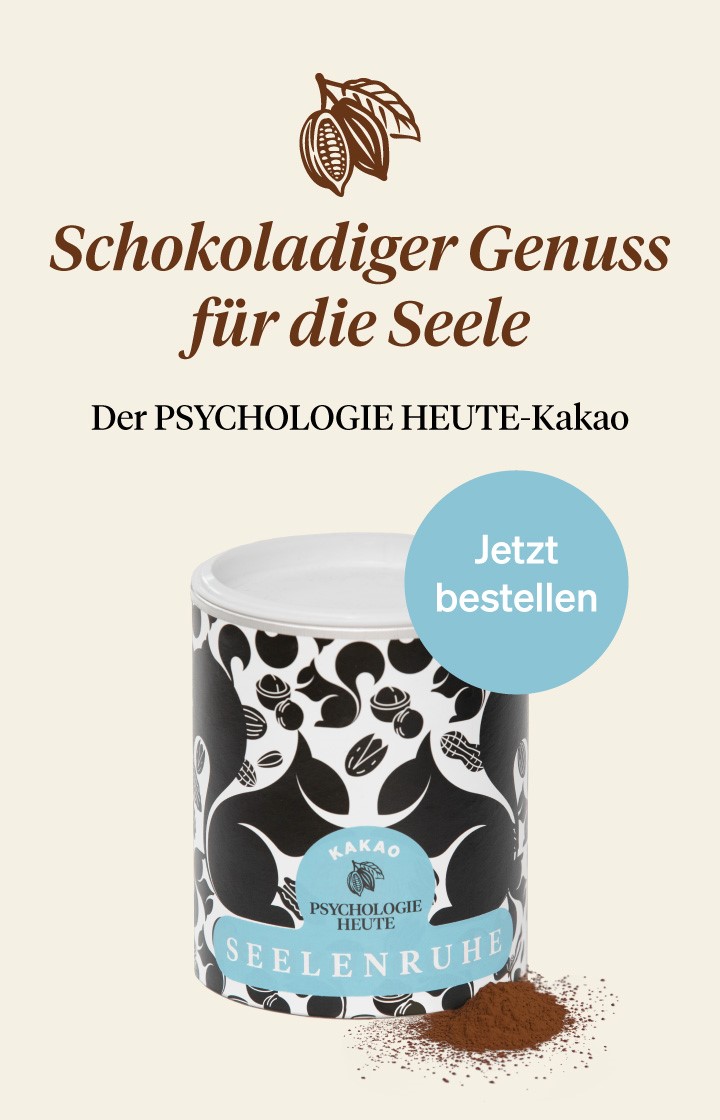Was genau versteht die Psychologie unter moralischen Verletzungen von Soldaten?
Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr erleben moralische Verletzungen meist bei oder nach Auslandseinsätzen. Es bedeutet, dass in einer schweren belastenden Situation eigene moralische, eigene Wertevorstellungen verletzt werden, entweder durch andere Beteiligte oder durch eigenes Verhalten.
Was heißt das in diesem Falle, „verletzen“?
Die Ereignisse widersprechen den eigenen Wertevorstellungen. Beispielsweise kollidiert der christliche Wert „Du sollst nicht töten“ im Einsatz bei einem Soldaten mit der Notwendigkeit, einen anderen Menschen töten zu müssen. Weil es die Situation so erfordert. Das ist eine klassische moralische Verletzung.
Ist das ein neues Konzept?
Unter diesem Begriff kam das Konzept erstmals 2009 in den USA auf (moral injury). Dass ethische Werte massiv auf Psyche und Traumaverarbeitung einwirken, ist allerdings schon seit Jahrzehnten in der wissenschaftlichen Diskussion. Im Grunde genommen haben schon die alten Griechen darüber nachgedacht. Dennoch war es sinnvoll, dieses ganz eigene psychische Phänomen neu zu konzipieren und zu erforschen, weil das Thema zu wenig im Bewusstsein von Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten war. Seit es wesentlich mehr wissenschaftliche Literatur zum Thema gibt, ist ein neues Bewusstsein dafür entstanden, auch bei uns in Deutschland.
Was sind die psychischen Konsequenzen einer moralischen Verletzung?
Die moralische Verletzung führt zu mehreren psychischen Reaktionen und Symptomen. Sie können so vielgestaltig sein wie die moralischen Verletzungen selbst, zum Teil hängt es davon ab, ob eine andere Person oder man selbst die Verletzung begangen hat. Waren es andere, vergleichen die Betroffenen deren Verhalten mit den eigenen Moralvorstellungen und stellen fest: Das kollidiert. Da entsteht ein innerer Widerspruch, denn Frauen und Kinder muss man ja schützen. Symptomatisch äußert sich das in einem Entfremdungsgefühl und in Zorn, der sehr hartnäckig sein kann. Typische moralische Verletzungen durch andere liegen vor, wenn es in Einsatzländern zu ethnischen Gewalttaten durch andere kommt, die sich gegen Frauen und Kinder richten.
Entstehen moralische Verletzungen durch eigenes Verhalten, vergleichen die Einsatzkräfte es mit ihren moralischen Überzeugungen, meist im Nachhinein, und stellen fest: „Oh Mann, das steht ja völlig im Widerspruch.“ Ein Beispiel: Soldatinnen und Soldaten sind füreinander da, sie sorgen füreinander. Wird nun in einer Einsatzsituation ein Kamerad oder eine Kameradin verletzt, kommt ein Gefühl von Hilflosigkeit hoch: „Ich konnte nicht eingreifen und helfen, obwohl ich es so wollte.“ Das erzeugt Schuldgefühle und Vorwürfe gegen sich selbst. Wenn die Schuldgefühle bleiben und nicht wieder gut gemacht werden können, gehen sie bei manchen Menschen in Scham über. Das heißt: Aus der Schuld, „ich habe einen Fehler gemacht“, wird ein „ich bin ein schlechter Mensch, ich bin sozial nicht mehr attraktiv und liebenswert“. Das steht einer psychiatrischen Symptomatik schon sehr nahe. In der Folge kann es zu einer Neigung kommen, sich selbst zu bestrafen oder zu verletzen, auch zu sozialem Rückzug, Isolation und Suchtverhalten. Und: Die Scham kann letztlich auch die Tür zum Suizid öffnen. Ob es soweit kommt, hängt natürlich vom Einsatzgeschehen ab. Wer in einem Auslandseinsatz in einem Lager gesessen hat, hat es leichter als jemand, der viel draußen war.
Wie häufig sind diese moralischen Verletzungen?
Wir haben das nie untersucht in der Bundeswehr. Auch die amerikanischen Kolleginnen und Kollegen nicht. Es gibt Schätzungen, die tatsächlich sagen, dass es bei einem großen Teil der Soldateinnenund Soldaten passiert, der in traumatische Situationen gerät.
Und in Kriegen wie in der Ukraine gerade?
Auch dort. Wenn Krieg herrscht, werden sowohl die beteiligten Soldatinnen und Soldaten als auch die Zivilbevölkerung in einer großen Zahl moralische Verletzungen davontragen. Es gibt zum Beispiel Untersuchungen der amerikanischen Streitkräfte aus dem Irakkrieg. Zehn Prozent aller Soldatinnenund Soldaten berichteten, Handlungen begangen zu haben, die sie selbst ethisch fragwürdig finden.
Wer neigt dazu? Kann es jedem passieren?
Grundsätzlich ja. Aber aus meiner klinischen Erfahrung weiß ich, dass es bestimmte Persönlichkeitstypen gibt, die anfälliger sind. Man kann Menschen nach ihren Wertevorstellungen in Gruppen einteilen. „Benevolenz“ ist eine solche Wertvorstellung. Wörtlich heißt das: das Gute wollen. Diese Personen sind besonders interessiert daran, Menschen in ihrer näheren Umgebung zu schützen. Ein ähnlicher Wert ist der sogenannte Universalismus. Da bezieht sich dieser Schutzinstinkt nicht nur auf die nähere, sondern auch die weitere Umgebung – auf Dinge wie Umweltschutz oder Sicherheit in Deutschland. Diese beiden Wertevorstellungen treten auch oft zusammen auf. Durch die Sozialisationsausbildung der Bundeswehr – sie lehrt, Kameradschaft zu leben - verstärken sie sich noch. Sie bilden einen Gegenpol zu Werten wie Hedonismus. Hedonistinnen und Hedonisten wollen eher das eigene materielle Wohl sichern, vielleicht sich nach dem Einsatz ein schönes Auto kaufen. Benevolente und Universalistinnen reflektieren für sie moralisch fragwürdige Ereignisse, grübeln darüber. Wenn sie sich dann hilflos fühlen, leiden sie darunter. Der Hedonist sagt eher: „Es gibt wichtigere Dinge für mich.“ Wir haben das in einer eigenen Studie untersucht.
Hängen moralische Verletzungen und Posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS) zusammen? Und wenn ja: wie?
Dazu gibt es Untersuchungen aus den USA. Ein Kollege hat zum Beispiel bei 1000 Soldatinnenund Soldaten nach Auslandseinsätzen analysiert: Wer hat PTBS, wer hat moralische Verletzungen, wer hat beides und welche Folgen hat das? Ergebnis: Ein Teil der Soldatinnen und Soldaten hatte PTBS, ein anderer Teil moralische Verletzungen. Dabei stellte sich heraus: Moralische Verletzungen und PTBS sind nicht einfach zwei Seiten einer Medaille, sondern zwei unterschiedliche Phänomene. PTBS hat die typischen Angstfolgen, Vermeidungsverhalten, Angespanntheit, Nervosität, während aus moralischen Verletzungen Scham, Schuld, Zorn, Enttäuschung resultieren. Aber: Es gibt eine Schnittmenge von Symptomen aus beiden Erkrankungen wie Suchtverhalten und Zorn. Die Kolleginnen haben sich diese Schnittmenge angesehen: Wie ist es mit suizidalem Verhalten? Sie haben festgestellt, dass sich das Suizidrisiko nur erhöht, wenn PTBS und moralische Verletzungen zusammenkommen.
Wie sind die klinischen Verläufe?
Sie reichen von milden bis zu sehr schweren Fällen. Bei Soldaten und Soldatinnen mit mehreren Auslandseinsätzen sehen wir oft schwere Verläufe. Scham und Zorn auf Vorgesetzte oder auf die Bevölkerung vor Ort mit sich herumzutragen erodiert die Persönlichkeit. Es zerstört ein gesundes Verhältnis zu sich selbst. Wer durch seine Scham nicht mehr das Gefühl hat, liebenswert zu sein, die oder der gönnt sich auch keinen Genuss mehr. So etwas geht dann oft in einen dauerhaften Zustand über. Das sehen wir bei vielen Patientinnen und Patienten bei uns im Krankenhaus. Sie sind durch Scham und Zorn völlig blockiert.
Je schneller man zur Therapie kommt, desto besser?
Unbedingt!
Welche therapeutischen Möglichkeiten gibt es?
Wir haben bei der Bundeswehr ein eigenes Therapieprogramm entwickelt und auch einen Ansatz für die Vorbeugung, also schon vor Auslandseinsätzen zum Beispiel.
Wie verläuft die Therapie?
Viele leiden an einer Kombination zwischen klassischen PTBS, also Angstsymptomatik, plus moralischen Verletzungen. Für die Arbeit mit diesen Patientinnen und Patienten nutzen wir ein Intervallkonzept, das alle drei bis sechs Monate ein mehrwöchiges Modul vorsieht, dazwischen gibt es ambulante Psychotherapie. Zunächst stabilisieren wir die Patienten, wir therapieren die Traumatisierung. Wir versuchen, Druck und Anspannung zu reduzieren.
In jedem Modul wird ein Themenschwerpunkt präsentiert. Zum Beispiel klassische traumatherapeutische Fragen. In ein bis zwei Modulen greifen wir ganz konkret die moralischen Verletzungen auf. Eine erste Woche ist dabei zum Kennenlernen und dient der Gruppendynamisierung. Das ist extrem wichtig, weil das Aussprechen moralischer Konflikte in einer Gruppe sehr heilsam sein kann. Die Patientinnenund Patienten fühlen sich dann untereinander verstanden und unterstützt: „Wir sind alle Soldaten, haben das gleiche erlebt, wir verstehen einander.“ Es ist ein ganz wichtiger Heilungsfaktor bei moralischen Verletzungen. In der zweiten Woche fahren wir in ein Kloster. Dort absolvieren wir ein interdisziplinäres einwöchiges Programm mit zwölf Doppelstunden. Wir arbeiten dort mit ärztlichen und psychologischen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Zudem stoßen regelmäßig ein bis zwei Pfarrer zu den Gruppen. Sie bieten kleine Andachten an oder nehmen, sofern die Patienten das wollen, auch eine Beichte ab.
Das bedeutet, bei dieser Problematik reicht eine Standard-Psychotherapie nicht aus?
Ja, es braucht schon etwas mehr als eine normale Psychotherapie, die Teil des Gesamtkonzeptes ist. In dem Intervallprogramm arbeiten wir die moralischen Konflikte genau durch. Wir schauen uns im ersten Schritt allgemein Werteorientierungen genauer an: Was ist das eigentlich, welche habe ich, was ist Benevolenz, was bedeutet sie für mich, welche Vor- und Nachteile hat sie? Im zweiten Schritt kommen wir zu moralischen Verletzungen, die durch andere hervorgerufen werden: Wie reagiere ich darauf, wie gehe ich mit meinem Zorn um, welche Folgen hat Zorn für mein Leben? Und im dritten Schritt bearbeiten wir die moralischen Verletzungen durch eigenes Verhalten: Habe ich Schuld auf mich geladen, wie gehe ich damit um, bin ich vielleicht schon im Bereich von Scham, was hat das für Auswirkungen? Etwa auf meine Familie, kann ich meinen Kindern noch guten Gewissens in die Augen sehen? Solche Gedanken gehen ans „Eingemachte“. Wenn die Schuldgefühle und die Selbstanklagen kommen, wird es oft erst einmal sehr still, bis die ersten Tränen fließen.
Zum Abschluss folgt noch eine Woche zum Abklingen, in der wir Fragen diskutieren: Wie kriege ich meine Erfahrungen aus der Therapie in mein tägliches Leben rein? Wie kommuniziere ich das meiner Familie? Wie stelle ich mich meinen täglichen Herausforderungen? Und so weiter.
Funktioniert diese Therapie in der Regel?
Ja. Wir haben sehr gute klinische Rückmeldungen. Wir haben das Ausmaß des Schamgefühls vor und nach der Therapie wissenschaftlich ermittelt. In drei von vier Bereichen, die Scham ausmachen, reduziert es sich deutlich und stabil. Das hat uns überzeugt.
Mit anderen Worten: Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern geht es wieder besser.
Richtig! Mit unserem Therapieprogramm auf jeden Fall. Von selbst und allein halte ich das für ausgeschlossen. Das muss ein erfahrener und geübter Therapeut übernehmen.
Peter Zimmermann ist Psychiater, Psychotherapeut und Oberstarzt am Bundeswehrkrankenhaus Berlin. Vor kurzem erschien sein Buch Trauma und moralische Konflikte bei Klett-Cotta.