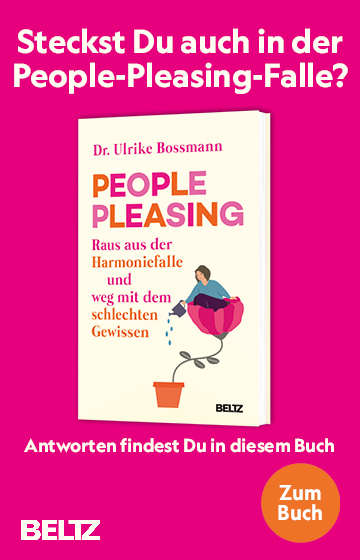Was ist eine „Papiermühle“ und wie sieht das Geschäftsmodell aus?
Es handelt sich um Agenturen, die zum Teil mehrere hundert Mitarbeitende haben und die auf Bestellung wissenschaftliche Artikel schreiben. Diese sind frei erfunden. Sie werden mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Die Firmen bezeichnen sich als editing agency, science support service oder ghostwriter.
Wer sind die Kundinnen und Kunden dieser Agenturen?
Es sind Forschende aus Ländern, in denen in der Wissenschaft enormer Druck herrscht. Es gibt in einigen Ländern spezielle Belohnungssysteme, beispielsweise in China, Indien und Ägypten. Dort werden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sehr viel veröffentlichen und oft zitiert werden, schnell befördert und sehr gut bezahlt. Aber wenn es einmal nicht klappt, droht ebenso rasch das berufliche Aus. Wir erkennen die Herkunftsländer an den Gesamt-zahlen wissenschaftlicher Studien. In China beispielsweise gibt es in den letzten 20 Jahren einen überproportional starken Anstieg an Studien. Es ist anzunehmen, dass darunter auch viele verdächtige oder gefälschte sind. Nach meiner Schätzung sind es in der Biomedizin im Jahr 2023 etwa sechzehn Prozent der Studien, rund 250000.
Sie sind selbst als peer reviewer tätig und einmal von einer solchen Agentur angesprochen worden. Was ist da passiert?
Mir wurde für ein schnelles Peer-Review-Verfahren und die Veröffentlichung von drei Manuskripten, die die Agentur liefern wollte, eine niedrige fünfstellige Summe angeboten. Es war glatte Bestechung. Ich war hellhörig, weil ich im deutschen Laborjournal bereits einmal über das Thema gelesen hatte.
Wie gehen die großen wissenschaftlichen Verlage mit dem Thema um?
Sie haben einen zusätzlichen Schritt eingeführt, die Manuskripte zu prüfen, bevor sie zum Review-Prozedere weitergeleitet werden. Nach außen zeigen sie sich eher schmallippig und erklären, das Thema im Griff zu haben. Ich bin mir da nicht so sicher.
Woran erkennt man gefakte Studien?
Das ist nicht einfach. Hier ein paar Hinweise: private E-Mail-Adressen des Autors, der Autorin; die Personen arbeiten an einem Krankenhaus oder in einer Firma und nicht an einer wissenschaftlichen Institution oder Universität. Verdächtig ist auch, wenn sehr viele Co-Autorinnen genannt sind, obwohl es nur ein einfaches Experiment ist. Eine oder mehrere zurückgezogene Arbeiten in der Literaturliste sind nicht vertrauenserweckend – dies kann man bei der Plattform Retraction Watch überprüfen. Auch ein Blick auf das Herkunftsland könnte helfen. Wenn man unsicher ist, kann man eine E-Mail an den korrespondierenden Autor schreiben. Antwortet dieser auch nach zweimaliger Nachfrage nicht, stimmt etwas nicht.
Sie befürchten, dass unser weltweites Wissen nach und nach unterminiert wird.
Es handelt sich aus meiner Sicht um eine systematische Verseuchung. Wenn immer mehr Wissen gefälscht ist und zunehmend in Fakeartikeln aus anderen Fakeartikeln zitiert wird, kommt es eines Tages zum Wissenskollaps – das Publikationssystem zerstört sich selbst. Wir brauchen dringend zusätzliche unabhängige Kontrollinstanzen, die Manuskripte vor der Publikation prüfen – und eine öffentliche Debatte.
Bernhard Sabel ist Neuropsychologe und war bis Ende 2023 Professor für medizinische Psychologie an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg.
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? Wir freuen uns über Ihr Feedback!
Haben Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Beitrag oder möchten Sie uns eine allgemeine Rückmeldung zu unserem Magazin geben? Dann schreiben Sie uns gerne eine Mail (an:redaktion@psychologie-heute.de).
Wir lesen jede Nachricht, bitten aber um Verständnis, dass wir nicht alle Zuschriften beantworten können.
Quelle
Bernhard A. Sabel: Mafia in der Wissenschaft. KI, Gier und Betrug. Kohlhammer Verlag 2024