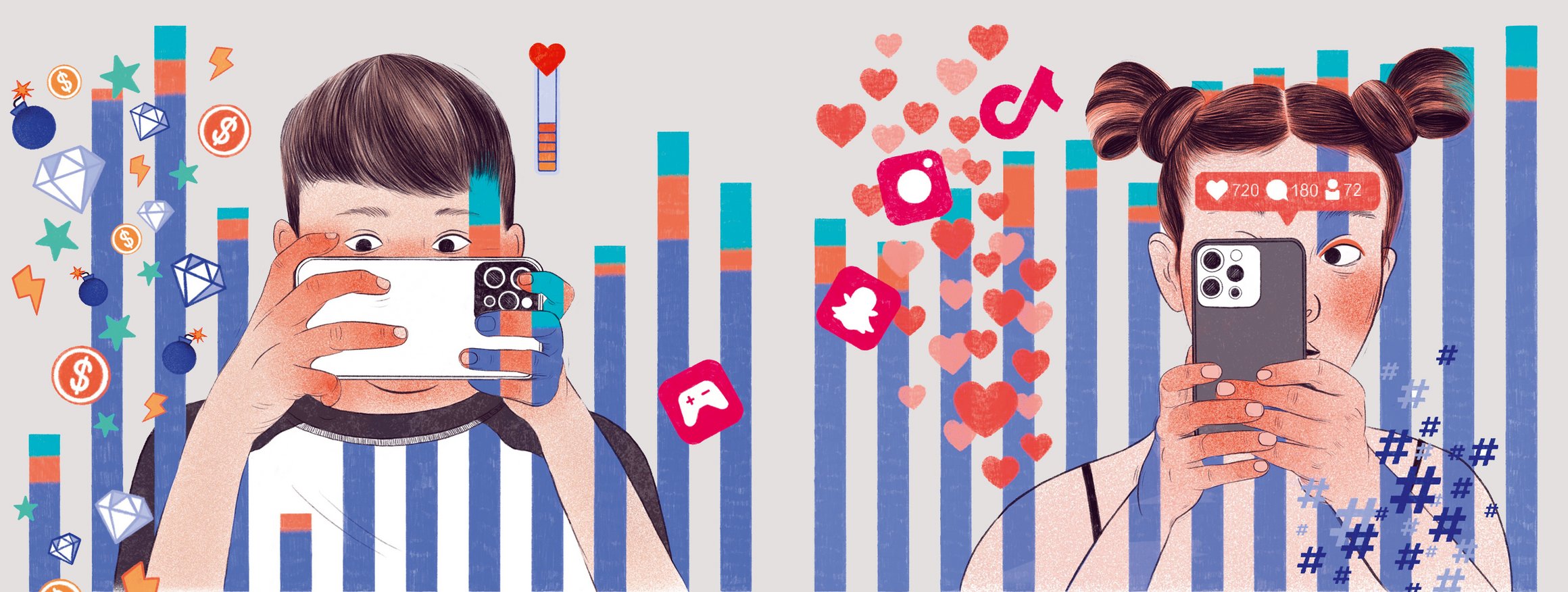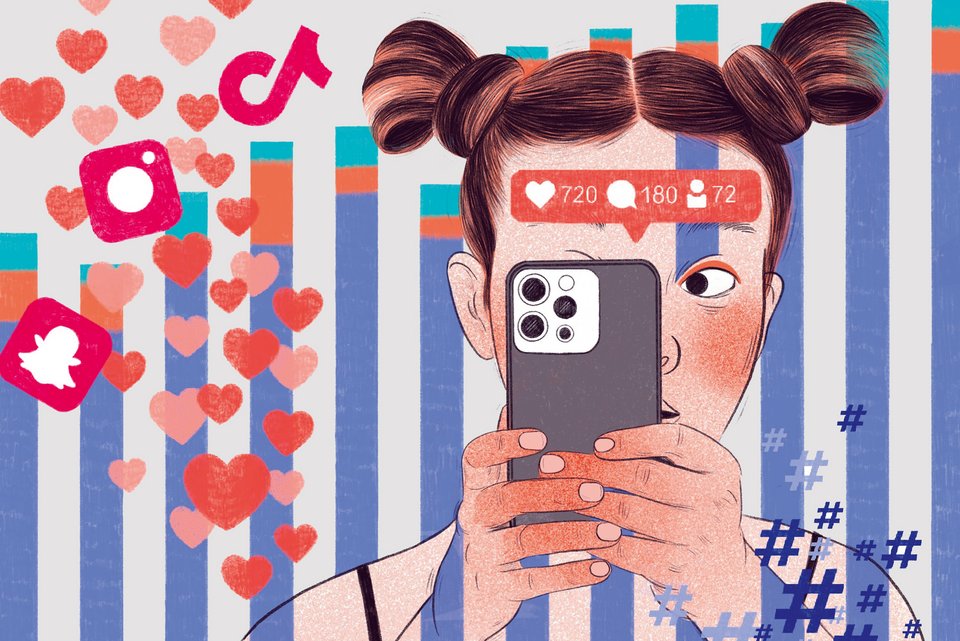Die Kinder der dritten Klasse einer Berliner Grundschule waren begeistert, als ein Mitschüler mithilfe seines Vaters einen lustigen Clip auf YouTube postete. Alle wollten das Video unbedingt anschauen. Großzügig verteilten sie gehobene Daumen für den Film des sonst eher stillen Jungen. Die Kinder sind acht und neun Jahre alt. Smartphones und soziale Medien gehören bereits zu ihrem Alltag. Viele haben eigene elektronische Geräte, ob Smartphone oder Tablet.
Der Einzelfall ist übertragbar, wie die Statistiken…
Sie wollen den ganzen Artikel downloaden? Mit der PH+-Flatrate haben Sie unbegrenzten Zugriff auf über 2.000 Artikel. Jetzt bestellen
haben eigene elektronische Geräte, ob Smartphone oder Tablet.
Der Einzelfall ist übertragbar, wie die Statistiken verraten: Sechs- bis Dreizehnjährige nutzen Bildschirme hierzulande durchschnittlich 175 Minuten täglich, besagen Daten von 2021. Die DAK-Suchtstudie kam 2023 bei den Zehn- bis Siebzehnjährigen auf deutlich höhere Werte: 346 Minuten, also knapp sechs Stunden verbrachten die Heranwachsenden werktags an elektronischen Geräten. Am Wochenende waren es noch mehr. Dafür hatte die Krankenkasse bundesweit in 1200 Familien gefragt, wie häufig die Mitglieder soziale Medien, Gaming und Streaming verwendeten.
Selbstverständlich digital aufwachsen
Kinder und Jugendliche wachsen ganz selbstverständlich digital auf und verbringen einen Teil des Tages vor Bildschirmen. Das ist ein tiefgreifender Wandel. Noch 2000 konnte man mit einem Handy außer Haus in aller Regel nicht online sein.
Experten beantworten Ihre Fragen beim PH Live-Talk „Mein Kind und das Smartphone“
Zum Thema „Mein Kind und das Smartphone“ findet am 25. März 2025 von 19 bis 20:30 Uhr ein Psychologie Heute Live-Talk statt.
Zu Gast bei Psychologie Heute Chefredakteurin Dorothea Siegle sind Medienpädagogin Dr. Iren Schulz sowie Dr. med. Dipl.-Psych. Kerstin Paschke, die als Geschäftsführende Oberärztin an der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychotherapie und -psychosomatik am UKE Hamburg arbeitet. Im digitalen Gespräch klären sie unter anderem folgende Fragen: Welche Folgen hat die digitale Nutzung? Und wie können Eltern Kinder und Jugendliche sinnvoll begleiten?
Wie wirkt sich die permanente Möglichkeit des Onlineseins auf die junge Generation aus? Bei dieser Frage werden derzeit drastische Befürchtungen laut, verdichtet im Bestseller des US-amerikanischen Psychologen Jonathan Haidt Generation Angst. Ihm zufolge sorgen die sozialen Medien für eine „Neuverdrahtung“ der kindlichen und jugendlichen Gehirne. Sie rauben den Heranwachsenden die spielebasierte Kindheit und ersetzen sie durch eine smartphonebasierte Sozialisation. Diese enthalte ihnen reale Erfahrungen vor – des Austestens von Risiken, des Scheiterns und Gelingens. Kinder und Jugendliche würden deshalb ängstlicher und depressiver; Selbstverletzungen und Suizide nähmen zu. Besonders ungünstig wirkten die sozialen Medien von TikTok über Instagram bis hin zu Facebook, argumentiert Haidt, und zwar vor allem auf Mädchen. Er begründet dies damit, dass Mädchen soziale Medien intensiver nutzten, wohingegen Jungs häufiger Computerspiele spielten.
Haidts Buch polarisiert. Und es hat der Debatte um die Folgen einer digitalen Kindheit Schwung verliehen. Wie bei fast jeder neuen technologischen Revolution wächst mit der Verbreitung die Sorge vor negativen Folgen, ob bei neuen Verkehrsmitteln, beim Fernsehen oder bei Computerspielen. Das Auto sei gefährlich, fanden Kritiker beispielsweise im ausgehenden 19. Jahrhundert – und bevorzugten kategorisch das Pferd. Und tatsächlich dauerte es zwanzig Jahre bis Geh- von Fahrwegen getrennt und 1909 der Führerschein eingeführt wurde. Die massenhafte Verbreitung von Airbags, die die Zahl der Verkehrstoten noch einmal deutlich reduzierte, dauerte sogar bis in die 90er Jahre des 20. Jahrhunderts.
Messgröße: Stunden am Bildschirm
Neu sind Haidts Befürchtungen nicht: Im vergangenen Jahr veröffentlichten neun Fachgesellschaften von der Kindermedizin bis zur Psychologie sowie die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gemeinsam eine Leitlinie zur Prävention von übermäßigem Mediengebrauch im Kindes- und Jugendalter: Kinder unter drei Jahren sollten demnach möglichst keine Zeit vor Bildschirmen verbringen. Zwischen sechs und neun Jahren sollten sie allenfalls bis zu 45 Minuten an einzelnen Tagen unter Aufsicht ihrer Eltern in die digitale Welt eintauchen. Die Autorinnen und Autoren sehen in einer unkontrollierten Digitalisierung der Kindheit ein Risiko für die psychische und kognitive Entwicklung der Heranwachsenden und pflichten Haidt damit grundsätzlich bei.
Ein Team vom Lehrstuhl für Kommunikationspsychologie und Neue Medien der Universität Würzburg stellte sich dagegen in einem Thesenpapier gegen Haidts Buch. Markus Appel, Silvana Weber und Fabian Hutmacher empfinden es als Verunglimpfung der digitalen Medien wie auch der Kinder und Jugendlichen. Haidt greife Daten einseitig zulasten der sozialen Medien heraus und stelle die Informationslage zu unausgewogen dar.
Was sagt die Studienlage? Untersuchungen zu einer möglichen Korrelation zwischen dem Befinden von Heranwachsenden und ihrer Bildschirmzeit gibt es reichlich und aus verschiedenen Ländern, so aus den USA, Großbritannien, Südkorea, Staaten der EU. Sie zeigen in der Tendenz ein Bild, das auf den ersten Blick eindeutig erscheint: Heranwachsende, die digitale Medien massiv nutzen, sind etwas furchtsamer und niedergeschlagener. Ängstlichkeit und Depressivität sind im Trend umso ausgeprägter, je mehr Zeit die jungen Menschen vor einem Monitor verbringen.
Doch so einfach zu deuten, wie es scheint, sind die Befunde nicht. Denn nach wie vor ist nicht abschließend klar, ob die Zeit im Netz die seelische Verfassung verschlechtert oder ob Kinder, die zu Ängsten und Depressionen neigen, schlicht mehr von digitalen Medien vereinnahmt werden. Für beide Wirkungen gibt es wissenschaftliche Belege.
„Man sieht bereits, dass Risiken bestehen.“
Und so bringt auch Markus Appel, Psychologe und Professor für Kommunikationspsychologie und neue Medien, ein Kernargument vieler Kritikerinnen von Haidt vor: „Es ist unklar, ob die digitalen Medien die Ursache der psychischen Auffälligkeiten sind oder ob es nicht vielmehr umgekehrt ist. Und ohnehin sind die beobachteten Effekte klein.“
Demgegenüber sehen andere Fachleute die Risiken digitaler Medien als hinreichend belegt an. Auf dieser Seite steht der Psychologe Jürgen Margraf von der Universität Bochum: „Man kann zum heutigen Zeitpunkt sicher sagen, dass digitale Medien, besonders soziale Medien, das Befinden verschlechtern. Die Menschen, auch Kinder und Jugendliche, werden ängstlicher, gestresster, weniger zufrieden und niedergeschlagener. Und die Effekte werden sehr wohl auch ursächlich durch die Medien hervorgerufen. Wir befinden uns aber in der Diskussion etwa da, wo wir bei Zigaretten in den sechziger Jahren standen: Man sieht bereits, dass Risiken bestehen. Aber es gibt noch Unsicherheiten.“
An diesem strittigen Punkt lohnt ein etwas detaillierterer Blick in die Daten: Nur Längsschnittstudien, die Veränderungen in der Bildschirmzeit und der psychischen Gesundheit über mehrere Jahre mehrmals abfragen, können klären, ob das stundenlange Surfen oder Chatten tatsächlich die Verfassung beeinträchtigt. Darüber hinaus sind Interventionsstudien besonders aussagekräftig, wenn also ein Teil der Probandinnen und Probanden aufgerufen wird, am Tag beispielsweise eine Stunde weniger auf TikTok und Co unterwegs zu sein, wohingegen ein anderer Teil sein Nutzungsverhalten beibehält. Im Anschluss daran erfragen Forschende das Befinden.
Die meisten Studien stützen sich auf die Zeit am Bildschirm, ganz egal ob Tablet, PC oder Smartphone. Das weist auf eine Schwierigkeit hin, mit der das ganze Forschungsfeld zu kämpfen hat: Die Geräte werden äußerst vielfältig genutzt – zum Lernen, zum Spielen oder Chatten. Am leichtesten erheben lassen sich jedoch die schlichten Stunden vor dem Bildschirm.
Wut und Trauer, wenn das Smartphone nicht da ist
Das sorgt für Kritik: „Studien über die Wirkung des Internets konzentrieren sich in unangemessener Weise auf quantitative Aspekte wie die Bildschirmzeit“, moniert etwa der Sozialpädagoge Linxiao Zhang von der Universität Toronto in Reaktion auf Haidts Buch. „Die Forschenden übersehen so, wie Kinder und Jugendliche das Internet wirklich nutzen.“ Insofern geben die verfügbaren Studien, die oft nicht oder kaum nach der Nutzung differenzieren, auch nur ein grobes erstes Bild.
Eine der ersten Längsschnittstudien aus Kanada lief über vier Jahre. Befragt wurden 3826 Zwölf- bis Dreizehnjährige. Die Erhebung zeigte, dass eine Stunde mehr am Bildschirm täglich im selben Jahr mit mehr Symptomen von Angst und schlechterer Stimmung einherging. Ein Hinweis darauf, dass sich die digitale Nutzung selbst ungünstig auf die Psyche auswirken kann.
Große Studien haben bekanntlich mehr Aussagekraft, weshalb sie hier bewusst herausgegriffen werden: Zuletzt verrieten koreanische Daten von 41000 Jugendlichen, dass die tägliche Zeit am Smartphone ab einer bestimmten Dauer das Wohlbefinden dämpft. Bei höchstens zwei Stunden Handyzeit am Tag gab es aber noch keinerlei Auswirkungen. Im Zeitfenster von bis zu vier Stunden täglich nahm die Abhängigkeit vom mobilen Gerät zu. Diese wird erfasst, indem nach dem Verlangen nach dem Smartphone gefragt wird, auch nach Gefühlen wie Wut oder Trauer, wenn es gerade nicht greifbar ist. Ab vier Stunden täglich sahen die Autoren schließlich psychische Auswirkungen: Die Zufriedenheit schwand, und zwar mit der Zeit am Smartphone. In der schlechtesten Verfassung waren jene, die mehr als acht Stunden am Tag am Handy zubrachten. Je länger die Jugendlichen ab dem kritischen Limit von vier Stunden täglich mit ihrem Gerät beschäftigt waren, desto gestresster und depressiver waren sie auch.
Die koreanischen Daten werden von den Befunden zu 40000 Kindern zwischen zwei und siebzehn Jahren aus den USA von 2018 ergänzt. Allerdings setzen sie die Schwelle der Harmlosigkeit niedriger – nämlich bei einer Stunde Bildschirm am Tag. Ab da wirkte sich dies auf die Heranwachsenden ungünstig aus: Sie waren weniger neugierig, hatten ihre Gefühle nicht so gut im Griff, es fiel ihnen schwerer, Freundschaften zu knüpfen. Und wieder nahmen auch bei diesen Heranwachsenden Depressionen und Angsterkrankungen mit den Stunden am Monitor zu.
Fernsehen statt Facebook?
Doch diese Tendenz ist keineswegs auf Kinder und Jugendliche beschränkt, sondern betrifft genauso Erwachsene. Und dasselbe gilt für den umgekehrten Zusammenhang, dass nämlich psychisch belastete Menschen sich viel mehr von ihren Geräten vereinnahmen lassen. Das zeigt beispielsweise eine Studie mit 125 Studierenden: Jene, die sich einsam und erschöpft fühlten, nutzten die sozialen Medien intensiver, und zwar vor allem passiv, fanden die Autoren. Sie weisen darauf hin, dass auch beide Wirkungen möglich sind: Medien könnten sowohl eine besondere Falle für psychisch Belastete sein als auch bei massiver Nutzung die Verfassung weiter verschlechtern.
Vor allem eines wird beim Blick in die Studien klar: „Es ist ungerecht, es so hinzustellen, als könnten nur die Jugendlichen bei übermäßigem Gebrauch unter dem Smartphone leiden“, sagt Markus Appel. Genauso wie die Wirkung des Fernsehens auf Kinder nicht substanziell anders ist als auf Erwachsene. Außerdem kommt es auf die ganz konkreten Inhalte der Filme, etwa auf deren Gewaltpotenzial an. Es gibt keinen Grund, weshalb das bei Onlinemedien anders sein sollte.
Soziale Medien gegen Einsamkeit
Soziale Medien und das Smartphone im Allgemeinen hätten aber auch positive Effekte auf die seelische Gesundheit, die nicht ausgeblendet werden dürften, führt Appel ins Feld. „Das Smartphone ist unser Draht in die Welt und zu anderen Menschen.“ Junge Menschen verabreden sich via Handy, tauschen Erinnerungsfotos und Hausaufgaben aus. Das Chatten hat das Telefonieren nahezu abgelöst. Je intensiver Menschen in den sozialen Medien unterwegs seien, umso mehr Kontakte hätten sie in der realen Welt, argumentiert der Psychologe. Beides lasse sich nicht voneinander trennen. Er stützt sich auf ältere Studien zum Sozialkapital, das abhängig von der Nutzung der sozialen Medien zunimmt.
Dazu passend legte das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung gerade erst im Oktober 2024 neue Daten zur Einsamkeit im jüngeren und mittleren Erwachsenenalter in Deutschland vor. Es unterschied dabei zum einen emotionale Einsamkeit, also wenn nahe Menschen für tiefgehende Gespräche fehlen, und zum anderen soziale Einsamkeit, wenn es an realer Unterstützung mangelte. Menschen, die das Internet rege nutzten, fühlten sich der Befragung zufolge emotional weniger einsam. Sie tauschten sich online mit ihren Nächsten aus. Allerdings: Eine große digitale Verbundenheit half nicht gegen einen Mangel an sozialer Unterstützung.
Als besonders aussagekräftig gelten in dieser komplexen Lage Studien, die Probandinnen und Probanden in zwei Gruppen einteilen: Der einen Hälfte wird dann weniger Zeit in den sozialen Medien oder am Smartphone zugestanden, wohingegen die anderen weitermachen wie bisher.
Ein eindrucksvolles Experiment unternahm 2018 ein Team um Hunt Allcott, damals noch an der New York University. Über programmierte Ads fragte er Facebooknutzerinnen jeden Alters, ob sie bereit seien, zu Forschungszwecken vier Wochen lang ihren Account zu deaktivieren. 2743 Personen waren bereit mitzumachen, wovon bei der Hälfte das Konto blockiert wurde. Allcott befragte die Ausgesperrten regelmäßig nach ihrem Wohlbefinden und den Folgen. Tatsächlich besserte sich die Stimmung der Facebook-Abstinenten geringfügig. Sie fühlten sich ein wenig zufriedener im Leben und berichteten seltener von Angst und Depressivität. Die Stunde täglich, die sie nun nicht auf Facebook verbrachten, nutzten sie sowohl fürs Fernsehen als auch für mehr Zeit mit Freunden und der Familie.
„Abstinenz funktioniert nicht. Da macht keiner mit.“
Jürgen Margraf, der Professor am Forschungs- und Behandlungszentrum für psychische Gesundheit der Universität Bochum ist, hat ähnliche Experimente an jungen Erwachsenen durchgeführt und meint: „Sie liefern alle dasselbe Ergebnis.“ Schon zwanzig Minuten Facebook weniger am Tag hatten in seinem ersten Experiment an 140 jungen Erwachsenen psychische Auswirkungen. „Sie waren klinisch bedeutsam weniger ängstlich. Ihre Stimmung war besser, und sie waren weniger gestresst. Andere Aktivitäten wie Sport nahmen zu und sie rauchten weniger Zigaretten“, schildert Margraf. Das Wohlergehen verbessere sich genauso, berichtet der Bochumer Psychologe von weiteren Studien, wenn Teilnehmende ermutigt würden, pauschal ihre tägliche Zeit am Smartphone zu reduzieren. Er hebt aber auch hervor: „Abstinenz funktioniert nicht. Da macht keiner mit.“
Ohne Handy geht es eben heutzutage nicht mehr. Im Lichte dieser Einsicht mutet ein Befund von Jonathan Haidt besonders furchterregend an. Das Smartphone bei Kindern und Jugendlichen stehe mit Selbstverletzungen und Suiziden in Zusammenhang, warnt er.
Eine Untersuchung an rund 11600 Neun- bis Elfjährigen aus den USA stützt diese Darstellung: Sie verbrachten durchschnittlich vier Stunden am Tag vor einem Bildschirm. Jede Stunde mehr am Tag mündete zwei Jahre später in mehr suizidalem Verhalten, also Suizidversuchen und entsprechenden Gedanken, dem eigenen Leben ein Ende zu setzen. Und auch eine Studie an 500 Jugendlichen über zehn Jahre kam zu diesem Schluss. Allerdings seien Frauen und Mädchen besonders verletzlich. Ein Muster, das Forschende immer wieder finden.
Das Smartphone tötet?
Gleichwohl gibt es auch Fachleute, die diese Ergebnisse infrage stellen, weil der Sachverhalt ebenfalls wieder andersherum liegen könnte: Heranwachsende, die ihr Leben beenden wollen, ziehen sich womöglich in eine Handywelt zurück, und zwar umso mehr, je stärker ihr Lebenswille erlischt.
Daten aus Deutschland erlauben bislang keine Schlüsse, sagt Markus Appel. Hierzulande sanken die Suizidraten über Jahre und stiegen 2022 und 2023 an. Mancher mag darin einen ähnlichen Trend wie in den USA erkennen. Aber bei einigen Dutzend Freitoten unter Minderjährigen ist es schwierig, überhaupt über den Einzelfall hinaus Trends abzuleiten.
Eine aktuelle Studie an 60 Jugendlichen rückt das mutmaßliche Suizidrisikopotenzial des Smartphones in ein anderes Licht: Sie konnte zeigen, dass Suizidgedanken besonders an den Tagen auftraten, an denen die Teilnehmenden Beleidigungen oder Kritik über die sozialen Medien ausgesetzt waren. Bekamen sie indes auf den digitalen Plattformen Lob und Anerkennung, waren sie sogar optimistischer gestimmt. Die Ursache für seelisches Leid ist demnach also Cyberbullying und nicht der Smartphonegebrauch an sich.
Unausweichlich läuft die Diskussion damit auf die Frage zu, was genau am Smartphone eigentlich die Psyche belastet. Am Smartphone können Jugendliche einkaufen, gemeinsam Lieder singen oder Informationen austauschen. Sie klicken Instagram-Clips an oder spielen. Genauso können sie sich gegenseitig schwer beleidigen, Pornos schauen oder auf betrügerische Erwachsene hereinfallen. „Hier braucht es eine differenzierte Betrachtung“, sagt Appel. „Haidt schießt über das Ziel hinaus, wenn er die sozialen Medien und das Smartphone pauschal für alles Schlechte verantwortlich macht. Es ist plausibel, dass es einen Unterschied macht, ob ein Kind mit Oma ein Videotelefonat führt oder TikTok-Videos schaut.“
Videokonsum dämpft die Stimmung
Dass dem Blick auf die Nutzung große Bedeutung zukommt, legt auch eine der wenigen Erhebungen aus Deutschland nahe, sie beruht allerdings auf älteren Daten: Ein Team um den Kommunikationsforscher Christian Schemer von der Universität Mainz setzte für den Zeitraum 2008 bis 2016 die Zufriedenheit von etwas mehr als 14000 Jugendlichen mit ihrer Mediennutzung in Beziehung. Es kam zu dem Schluss: Wenn man das Filmeschauen beiseite lässt, hat sowohl die Zeit im Internet als auch in sozialen Medien – damals studiVZ und Facebook – gar keinen Einfluss auf das Wohlbefinden. Und dass ein reger Konsum von Videos die Stimmung etwas dämpft, sei, so Schemer, schon lange aus der Forschung bekannt. Er fordert deshalb in seiner Publikation von 2021, dass Studien zu den Folgen des Onlineseins das Filmeschauen immer ausklammern müssten.
Auch deutet sich in den Studien der letzten Jahre an, dass die passive Nutzung ungünstiger sein könnte als die aktive Verwendung digitaler Dienste. Das bloße Schauen von Videos oder Lesen von Posts wäre demnach eher von Nachteil.
Neben dem passiven Konsum digitaler Inhalte konzentriert sich die jüngere Forschung auf die Frage, ob soziale Medien riskanter sind als andere Nutzungsarten, die Haidt in erster Linie für den Niedergang der psychischen Gesundheit der jungen Generation verantwortlich macht, weil es sie permanent ablenke und ihr Bedürfnis nach Bindung und Anerkennung ausnutze. Aber auch hier sind die Befunde teils noch uneinheitlich: Eine Erhebung an 671 flämischen Jugendlichen ergab zwar, dass jene, die auf Instagram surften, zu einem späteren Messzeitpunkt eher depressiv waren. Wenn sie aber auf der Plattform vorwiegend Likes austeilten, statt nur passiv zu konsumieren, wirkte sich das nicht negativ auf das Wohlergehen der Jugendlichen aus.
Hürde Datenschutz bei der Erforschung
„Wir wären froh, wir hätten mehr Daten – gerade von Kindern und Jugendlichen“, räumt Margraf ein. Er beklagt, wie schwer es sei, hierzulande Befragungen an Minderjährigen durchzuführen. Datenschutz und die ethischen Anforderungen seien hoch, wohingegen die Techindustrie weitgehend unbeschränkt sogar auf Kleinkinder zugehe und Daten über ihr Nutzerverhalten sammeln dürfe. „Das ist natürlich ein kapitales Ungleichgewicht. Die Forschung hinkt dadurch der massiven Durchdringung der Technologie hinterher.“ Im Umgang mit den digitalen Medien bräuchten wir das, was wir beim Auto über mehr als ein Jahrhundert entwickelt haben, glaubt Appel: „Führerschein und Verkehrsregeln, sprich: Medienkompetenz und durchaus auch Auflagen für die Anbieter.“
Hierzu in unserer nächsten Ausgabe: „Gib das Handy her!“ Wie können Eltern die Smartphonenutzung ihrer Kinder regulieren? Eine FAQ
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? Wir freuen uns über Ihr Feedback!
Haben Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Beitrag oder möchten Sie uns eine allgemeine Rückmeldung zu unserem Magazin geben? Dann schreiben Sie uns gerne eine Mail (an: redaktion@psychologie-heute.de).
Wir lesen jede Nachricht, bitten aber um Verständnis, dass wir nicht alle Zuschriften beantworten können.
Quellen
Jan Frölich, Gerd Lehmkuhl: Medienkonsum von Kindern und Jugendlichen. Risiken und Chancen. Schattauer 2023 (überarbeitete und erweiterte Neuauflage)
Jan-Philipp Stein, Silvana Weber, Fabian Hutmacher, Markus Appel: Social Media und Wohlbefinden. In: Markus Appel, Fabian Hutmacher, Christoph Mengelkamp, Jan-Philipp Stein, Silvana Weber (Hg.): Digital ist besser?! Psychologie der Online- und Mobilkommunikation. Springer 2023, 95–110
Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin e.V. (DGKJ): SK2-Leitlinie: Leitlinie zur Prävention dysregulierten Bildschirmmediengebrauchs in der Kindheit und Jugend. 2022 (1. Auflage). PDF-Datei zum kostenlosen Download: t1p.de/PH-Bildschirmmediengebrauch
George Aalbers, Richard McNally u.a.: Social media and depression symptoms: A network perspective. Journal of Experimental Psychology: General, 2019, DOI: 10.1037/xge0000528, 1454–1462
Hunt Allcott, Luca Braghieri u.a.: The Welfare Effects of Social Media. American Economic Review, 2020, DOI: 10.1257/aer.20190658, 629–676
Elroy Boers, Mohammad H. Afzali u. a.: Temporal Associations of Screen Time and Anxiety Symptoms Among Adolescents. Canadian journal of psychiatry, 2019, DOI: 10.1177/0706743719885486, 206-208
Julia Brailovskaia, Fabienne Ströse, u.a.: Less Facebook use – More well-being and a healthier lifestyle? An experimental intervention study. Computers in Human Behavior, 2020, DOI: 10.1016/j.chb.2020.106332
Jonathan Chu, Kyle T. Ganson u.a.: Screen time and suicidal behaviors among U.S. children 9-11 years old: A prospective cohort study. Preventive medicine, 2023, DOI: 10.1016/j.ypmed.2023.107452, 1-11
Sarah M. Coyne, Jeffrey L. Hurst u.a.: Suicide Risk in Emerging Adulthood: Associations with Screen Time over 10 years.Journal of Youth and Adolescence, 2021, DOI: 10.1007/s10964-020-01389-6, 2324–2338
Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin e.V. (DGKJ) u. a.: Leitlinie zur Prävention dysregulierten Bildschirmmediengebrauchs in Kindheit und Jugend. AWMF online, 1. Auflage 2022, 1-57.
Deutsches Zentrum für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters: Problematische Mediennutzung im Kindes- und Jugendalter in der post-pandemischen Phase. Ergebnisbericht 2023. Ausgewählte Ergebnisse der sechsten Erhebungswelle im August/ September 2023, 1-18.
Maria Carolina Juvêncio Francisquini, Thais Maria de Souza Silva u. a.: Associations of screen time with symptoms of stress, anxiety, and depression in adolescents. Revista paulista de pediatria, 2024, DOI: 10.1590/1984-0462/2025/43/2023250, 1-6
Eline Frison, Steven Eggermont u.a.: Browsing, Posting, and Liking on Instagram: The Reciprocal Relationships Between Different Types of Instagram Use and Adolescents' Depressed Mood. Cyberpsychol Behav Soc Netw, 2017, DOI: 10.1089/cyber.2017.0156, 603-609
Christopher Ferguson, Linda Kaye, u.a.: Like this meta-analysis: Screen media and mental health. Professional Psychology: Research and Practice, 2022, DOI: 10.1037/pro0000426, 205–214
Jessica L Hamilton, Maya Dalack u.a.: Positive and negative social media experiences and proximal risk for suicidal ideation in adolescents. Journal of Child Psychol Psychiatry, 2024, DOI: 10.1111/jcpp.13996, 1580-1589
Jong Ho Cha, Young-Jin Choi u.a.: Association between smartphone usage and health outcomes of adolescents: A propensity analysis using the Korea youth risk behavior survey. Plos One, 2023, DOI: 10.1371/journal.pone.0294553, 1-13
Asaduzzaman Khan, Eun-Young Lee u. a.: Dose-dependent and joint associations between screen time, physical activity, and mental wellbeing in adolescents: an international observational study. Lancet Child & Adolescent Health, 2021, DOI: 10.1016/s2352-4642(21)00200-5, 729-738
Fengxia Lai, Lihong Wang u.a.: Relationship between Social Media Use and Social Anxiety in College Students: Mediation Effect of Communication Capacity. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2023, DOI: 10.3390/ijerph20043657
Dong Liu, Sarah Ainsworth u.a.: A Meta-Analysis of Social Networking Online and Social Capital.Review of General Psychology, 2016, DOI: 10.1037/gpr0000091, 369-391
Avelina Lovis-Schmidt, Mihaly Peterfy, u. a.: Bildschirmkonsum und kognitive Kompetenzen im Kindes- und Jugendalter. Lernen und Lernstörungen, 2022, 1 – 13
Jason M. Nagata, Abubakr A. A. Al-Shoaibi u. a.: Screen time and mental health: a prospective analysis of the Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD) Study. BMC Public Health, 2023, DOI: 0.1186/s12889-024-20102-x, 1-13
Emily B. O’Day, Richard G. Heimberg: Social media use, social anxiety, and loneliness: A systematic review. Computers in Human Behavior Reports, 2021, DOI: 10.1016/j.chbr.2021.100070, 1-13
Katie N. Paulich, Megan Ross u. a.: Screen time and early adolescent mental health, academic, and social outcomes in 9- and 10- year old children: Utilizing the Adolescent Brain Cognitive Development ℠ (ABCD) Study. Plos One, 2021, DOI: 10.1371/journal.pone.0256591, 1-23
Renata Maria Silva Santos, Camila Guimarães Mendes u. a.: The associations between screen time and mental health in adolescents: a systematic review. BMC Psychology, 2023, DOI: 10.1186/s40359-023-01166-7, 1-21
Christian Schemer, Philipp K. Masur u. a.: The Impact of Internet and Social Media Use on Well-Being: A Longitudinal Analysis of Adolescents Across Nine Years. Journal of Computer-Mediated Communication, 2021, DOI: 10.1093/jcmc/zmaa014, 1–21
Jean Twenge, Eric Farley u.a.: Not all screen time is created equal: associations with mental health vary by activity and gender. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 2021, DOI: 10.1007/s00127-020-01906-9207–217, 207-217
Jiayao Xu, Bushra Farooq u. a.: Adverse Childhood Experiences and Excessive Recreational Screen Time Among Adolescents in the United Kingdom: A National Longitudinal Study.The journal of adolescent health, 2024, DOI: 10.1016/j.jadohealth.2024.05.016, 451-460